I. Die Schlangen der Laokoongruppe.
Gespräche mit dem Herpetologen Herrn Prof. Dr. Wolfgang Böhme
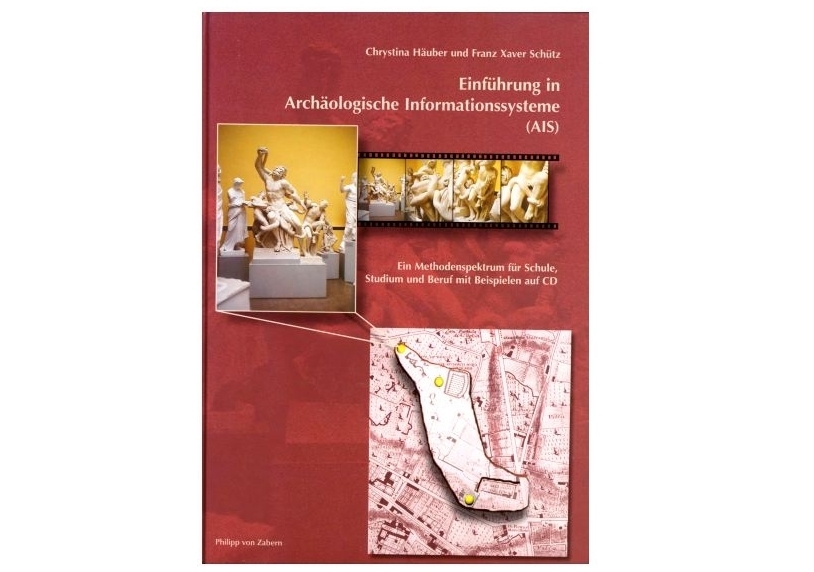
3. Dia. Titelbild des Buches "Einführung in Archäologische Informationssysteme (AIS)" von C. Häuber und F.X. Schütz (2004).
Daß ich aber überhaupt irgend etwas mit der Ihnen heute vorgestellten Thematik zu tun bekommen habe, verdanke ich meinem Mann, Franz Xaver Schütz, und einigen Studierenden am Institut der Klassischen Archäologie an der Universität Bonn, und das kam so.
Mein Mann, der als Geograph und gelernter Programmierer so etwas kann, hat mit mir zusammen 2001 in der Bibliothek des Bonner Archäologischen Instituts damit angefangen, für den Aufbau dessen zu recherchieren, was wir später als `Archäologisches Informationssystem´, kurz `AIS´, bezeichnet haben. Unser spezielles Informationssystem, mit dem wir unsere Romforschungen unterstützen, sollte später den Titel "AIS ROMA" bekommen. Nach einer Weile haben uns die Studierenden gefragt, was wir denn da täten, fanden es interessant, und wir wurden eingeladen, mit ihnen eine Lehrveranstaltungen zu dieser Thematik durchzuführen. Die Veranstaltung hieß seit Sommersemester 2001: "Einführung in Archäologische Informationssysteme", wurde insgesamt drei Mal in Bonn von uns durchgeführt, und die Aufgaben, die wir den Studierenden in diesen drei verschiedenen Übungen gestellt hatten, sind von meinem Mann und mir 2004 publiziert worden. Das Titelbild des Buches sehen Sie auf dem hier gezeigten Dia 3.
Am Ende dieser drei Übungen haben wir im Sommersemester 2002 alle ein eigenes AIS gebaut. Das war möglich, weil auch zum Bonner Institut eine bedeutende Gipssammlung gehört, die Teil des Akademischen Kunstmuseums ist. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Übung wählten ihr Stück in der Sammlung selbst aus. Alle haben zunächst ihre Skulpturen studiert und die jeweiligen Problematiken dann mit allen anderen besprochen, um festzustellen, was am jeweiligen Stück filmisch festgehalten werden sollte. Dann wurden Texte zu den gewählten Stücken verfaßt, in denen die spezifischen Probleme angesprochen wurden, dann wurden Filmaufnahmen der entsprechenden Gipsabgüsse angefertigt. Alle haben ihre Filmaufnahmen selbst gemacht, dann haben alle ihren Text selbst gesprochen und am Ende die jeweiligen Informationen zusammengeführt zu ihrem eigenen, individuellen AIS, festgehalten auf einer CD. Natürlich waren weder diese Texte, noch die Filmsequenzen sehr lang, weil wir alle gemeinsam an einem Nachmittag mit unseren Aufnahmen fertig werden wollten - was wir auch geschafft haben.
In dem Buch, das mein Mann und ich dazu verfaßt haben, finden Sie auf der beiliegenden CD natürlich nur die Aufgabe, die ich mir selbst in Wort und Bild gestellt hatte: Die Schlangen der Laokoongruppe. Auf dem hier gezeigten Titelbild des Buches sehen Sie sozusagen `Standphotos´ aus meinem Film über die Laokoonschlangen. Meinen gesprochen Text können Sie sich auf der CD anhören und die Filmsequenz dazu ansehen. Unten rechts auf dem Titelbild unseres `AIS´- Buches sehen Sie außerdem meinen ersten Versuch, den genauen Fundort der Laokoongruppe zu ermitteln. Auch dieses Thema hatten wir mit den Studierenden dieser Übungen diskutiert und eine entsprechende Aufgabe gestellt (ich werde am Ende meines Textes darauf zurückkommen, siehe unten, zu Dia 47.B).
Zur Vorbereitung meines AIS über die Schlangen der Laokoongruppe haben wir uns erst einmal tagelang gemeinsam den Bonner Gips der Gruppe12 angeschaut, dieser zeigt übrigens ein ähnliches Ergänzungsstadium wie der Gipsabguss, vor dem wir uns hier befinden (vergleiche Dia 3). Dann haben wir gemeinsam versucht, die Längen beider Schlangen zu bestimmen, was gar nicht so einfach war.
Ich erzähle Ihnen absichtlich noch nichts über den darstellten Mythos, den die Laokoongruppe visualisiert - das kommt später dran.
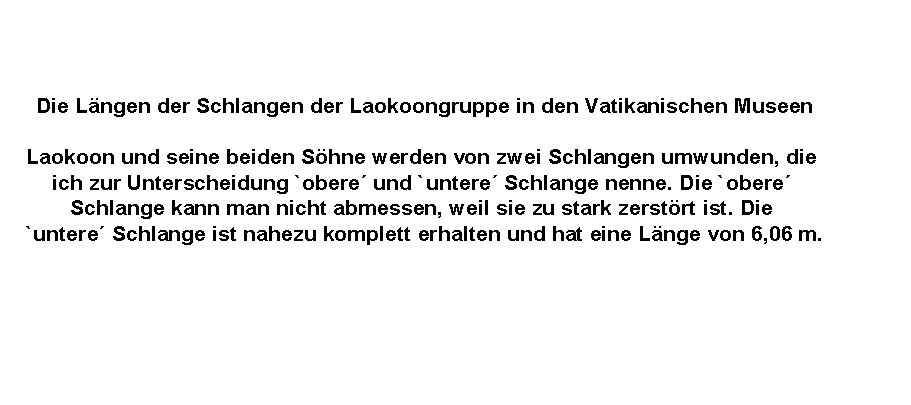
4. Dia. Die Längen der Schlangen der Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen.
Laokoon und seine beiden Söhne werden von zwei Schlangen umwunden, die ich zur Unterscheidung `obere´ und `untere´ Schlange nenne. Die `obere´ Schlange kann man nicht abmessen, weil sie zu stark zerstört ist. Die `untere´ ist nahezu komplett erhalten und hat eine Länge von circa 6,06 m. Diese Messung hat Franz Xaver Schütz am 28. Mai 2002 am Gipsabguss der Laokoongruppe im Akademischen Kunstmuseum Bonn vorgenommen.
Und damit komme ich zu dem Teil meiner Ausführungen, der mich dazu veranlaßt hat, Sie hier in das Museum für Abgüsse zu lotsen.
Zunächst brauche ich erst einmal einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, mit dem oder der ich gemeinsam den Faden `lang ziehe´, mit dessen Hilfe mein Mann die Länge der unteren Schlange bestimmt hat. Diesen Faden hat er dabei am Bonner Gipsabguss immer auf die `Mittellinie´ der `unteren´ Schlange gelegt, die - praktischerweise - als Grat ausgebildet ist. Gemeinsam mit allen Studierenden hatten wir dann festgestellt, dass beide Schlangen `Knoten´ beschreiben.
[Faden lang ziehen]
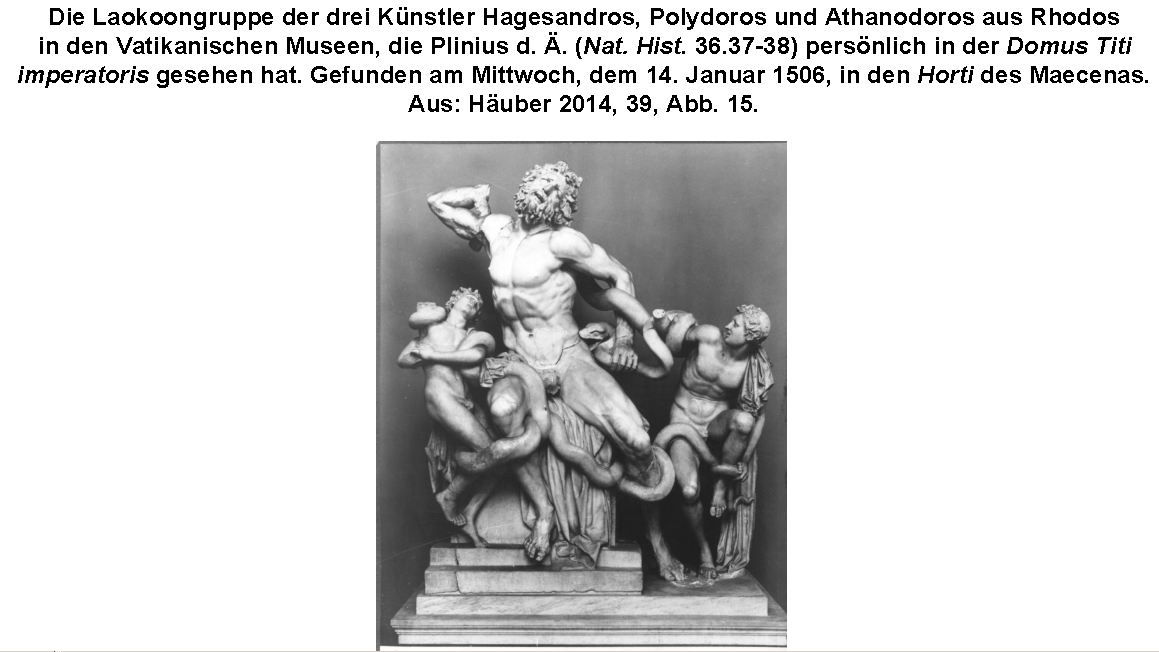
5. Dia. Laokoongruppe, parischer Marmor; vergleiche P. Liverani (2006, 31, Anm. 25). H. "208 x 163 x 112 cm"; vergleiche F. Buranelli et al. (2006, 119, cat. 1 [P. Liverani]). Città del Vaticano, Musei Vaticani (Inv. Nr. 1059, 1064, 1067), ein Werk der Künstler Athanodoros, Hagesandros und Polydoros aus Rhodos, das Plinius der Ältere (nat. hist. 36, 37-38) in Titi imperatoris domo gesehen hatte; gefunden 1506 in der Vigna des Felice de Fredis, in den Horti des Maecenas; meiner Meinung nach innerhalb der augusteischen Domus 55a-d. Das Photo zeigt F. Magis (1960) Restaurierung der Laokoongruppe. Aus: C. Häuber 2014, 39 Abb. 15.
Nachdem wir uns, mit Hilfe dieses Fadens, klar gemacht haben, dass die `untere´ Schlange tatsächlich eine enorme Länge aufweist, schauen wir uns nun zunächst einmal auf diesem Dia 5 und am Gipsabguss die Vorderseite der Laokoongruppe an und ich sage Ihnen dabei, wo sich diese `Knoten´ der Schlangen befinden. Auf dieser Seite, wie grundsätzlich überall, sind beide Schlangenkörper in sehr hohem Relief wiedergegeben, sie haften also so weit als eben möglich am jeweiligen Untergrund, Durchbrüche gibt es nur da, wo es sich nicht vermeiden ließ.
Bitte beachten Sie am Gipsabguss und auf diesem Dia und den folgenden (vergleiche Dias 6; 18; 21; 22; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 35), dass die `Mittellinien´ der beiden Schlangen jeweils durch einen durchlaufenden, plastischen Grat angegeben sind.
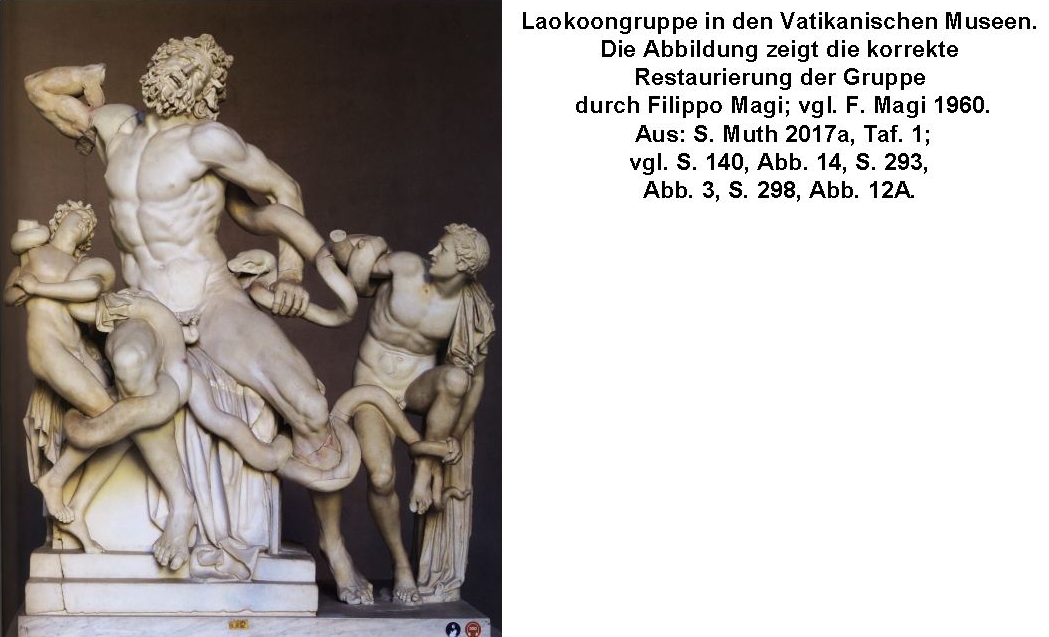
6. Dia. Photo von Magis Restaurierung der Laokoongruppe. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 1.
Dabei sage ich Ihnen jetzt noch nicht, wie eine Schlange tatsächlich vorgehen würde, wenn sie Beute macht: Dann müßten wir nämlich beim Kopf der Schlange anfangen, sondern ich beschreibe zunächst nur die `Knoten´, indem ich die Vorderseite der Gruppe von rechts nach links mit Ihnen abgehe.
Die `untere´ Schlange macht den ersten `Knoten´ um den linken Knöchel des älteren Sohnes - das ist der Knabe rechts vom Laokoon. Den zweiten `Knoten´ macht die `untere´ Schlange um das linke Bein des Laokoon, den 3. `Knoten´ macht die `untere´ Schlange um beide Beine des jüngeren Sohnes - das ist der Knabe links vom Laokoon, gleichzeitig ist dieser 3. `Knoten´ um das linke Bein des Laokoon gelegt. Als nächstes windet sich die `untere´ Schlange um den linken Oberarm des jüngeren Sohnes und beschreibt ihren 4. `Knoten´ um die rechte Schulter des jüngeren Sohnes. Schließlich beißt die `untere´ Schlange den jüngeren Sohn unterhalb des rechten Brustmuskels, man kann den rechten Hauerzahn der Schlange erkennen.
Die `obere´ Schlange macht einen `Knoten´ um den rechten Oberarm des älteren Sohnes. Wie wir gleich im nächsten Dia sehen werden, macht die `obere´ Schlange auch einen komplizierten `Knoten´ um den rechten Ober- und Unterarm des Laokoon (an dem vor uns stehenden Gipsabguss ist der rechte Arm des Laokoon ja noch falsch ergänzt, weshalb man das an diesem Gipsabguss nicht sieht). Die `obere´ Schlange beißt den Laokoon in dessen linke Hüfte. An der Stelle, wo bereits der Renaissance-Restaurator den Kopf der `oberen´ Schlange ergänzt hat, und wo auch Magis Restaurierung einen ergänzten Schlangenkopf aufweist, ist am Original eine entsprechende Bosse erhalten. Davon habe ich mich mehrfach vor dem Original selbst überzeugt, und ich werde Ihnen später auch im Dia zeigen, wie diese Bosse aussieht. Wegen dieser zutreffenden Restaurierung der Gruppe mit dem Kopf der `oberen´ Schlange, die den Laokoon in dessen linke Hüfte beißt, habe ich mir gewünscht, dass wir heute gemeinsam diesen Gips anschauen können.
Ehe ich mit Ihnen Detailbeobachtungen an der Laokoongruppe bespreche, nur steckbriefartig ein paar Informationen. Die Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen wurde am Mittwoch, dem 14. Januar 1506 in der Vigna (einem Weingarten) des Felice de Fredis bei den sogenannten Sette Sale auf dem Esquilin entdeckt. `Sette Sale´ ist die Bezeichnung der riesigen, circa 8 Millionen Liter Wasser fassenden überirdischen Zisterne der Trajansthermen.
Eine Laokoongruppe aus Marmor wurde von Plinius dem Älteren (nat. hist. 36.37)13 in der domus Titi imperatoris (im Haus des imperators/ Generals Titus), des Sohnes des Kaisers Vespasian, beschrieben. Plinius nannte auch die ausführenden Künstler, Hagesandros, Polydoros und Athanodoros aus Rhodos, und zog die Gruppe ausdrücklich allen anderen Werken der Malerei und Skulptur vor. Das Sujet der Gruppe im Vatikan wurde bereits bei ihrer Auffindung erkannt14, sie selbst mit dem von Plinius beschriebenen Werk identifiziert, und `folglich´ ihr Fundort als zur domus des Kaisers Titus gehörig angesehen. Nur die letzte Annahme war nicht (ganz) richtig.
Da Plinius seine Naturalis Historia, in welcher er die Laokoongruppe beschreibt, dem Titus bereits im Jahre 77 n. Chr.15 gewidmet hat, war Titus zwar zu diesem Zeitpunkt bereits von seinen Soldaten (seit 70 n. Chr.) akklamierter imperator (siegreicher General), Kaiser war dagegen zu diesem Zeitpunkt sein Vater Vespasian16 (ich werde auf den Fundort der Laokoongruppe anläßlich der Diskussion von Dia 48 noch einmal zurückkommen).
Was stellt die Laokoongruppe dar?
Die Bestrafung des Laokoon. Er war Trojaner und Priester des Apollon, was man an seinem Lorbeerkranz erkennen kann, den wir uns später anschauen werden (vergleiche Dia 35). Als die Griechen Troja trotz jahrelanger Belagerung nicht einnehmen können, ersinnen sie die Kriegslist des sogenannten Trojanischen Pferdes: Sie ziehen zum Schein ab und lassen dieses Pferd zurück. Das Pferd ist eine hohle Holzskulptur und dient als Versteck für einige Griechen. Die Trojaner halten Rat und beschließen, das Pferd als ein Weihgeschenk für ihre Stadtgöttin Athena anzunehmen, und schicken sich deshalb an, das Pferd - genau, wie von den Griechen intendiert - in ihre Stadt zu bringen. Laokoon, der Priester und Seher, erhebt warnend seine Stimme, er setzt sich aber nicht durch, das trojanische Pferd wird in die Stadt Troja gezogen. Dann geschieht alles so, wie von den Griechen antizipiert: Die Griechen, die sich in dem Holzpferd versteckt gehalten hatten, kommen, von den Trojanern unbemerkt, hervor, öffnen den anderen Griechen die Tore Trojas, und Troja wird von den Griechen komplett zerstört.
Da sich die olympischen Götter, was diesen Krieg betraf, in zwei Parteien gespalten hatten, insgesamt aber der Fall Trojas beschlossen war, wird Laokoon, der diesen Plan beinahe vereitelt hätte, bestraft: Zwei von den Göttern gesandte Schlangen kommen übers Meer, um Laokoon und seine Söhne zu töten. Es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte, die sich in zahlreichen Details voneinander unterscheiden17; in Vergils Aeneis (II, 40-56. 199-234) ist Laokoon zum Beispiel ein Neptunpriester, der also mit Sicherheit keinen Lorbeerkranz getragen hat. Die Gruppe im Vatikan folgt der Version des Arktinos18, derzufolge Laokoon ein Apollonpriester ist: In dieser Version sterben nur Laokoon und sein jüngerer Sohn, während sich der ältere Sohn retten kann. Sie sehen es an der Gruppe in den Vatikanischen Museen auch daran, dass sich Laokoon und der jüngere Sohn am/ auf dem Altar befinden, der ältere Sohn dagegen rechts neben dem Altar; Laokoon hat sich mit seinen Söhnen an den Altar seines Gottes Apollon geflüchtet, in der (vergeblichen) Hoffnung, von ihm gerettet zu werden19.
Was hat nun die Römer an der Laokoongeschichte interessiert?
Ganz einfach: In Vergils Aeneis wird die Geschichte teleologisch auf Octavian/ Augustus bezogen: Laokoon hat einen Bruder, den Anchises, der mit der Göttin Aphrodite den Aeneas gezeugt hat. Und nur, weil Aeneas, mit seinem lahmen Vater Anchises auf den Schultern, und seinem kleinen Sohn Askanios an der Hand, aus Troja flieht, kann, wie vorhergesagt, nach den langen Irrfahrten des Aeneas die Stadt Rom gegründet werden. Der Sohn des Aeneas, Askanios, wurde von den Römern Iulus genannt und von der Familie der Julier als Ahnherr reklamiert, weshalb Julius Caesar als seine Ahnfrau die Göttin Aphrodite ansah, und sein Adoptivsohn Octavian/ Augustus desgleichen20.
Es war Papst Julius II., der die Laokoongruppe erworben, und damit "il primo nucleo delle collezioni pontificie" (F. BURANELLI) schuf, aus denen in den folgenden Jahrhunderten die Musei Vaticani entstehen sollten. Julius II. hat sich beeilt, das oben Gesagte auf sich selbst zu beziehen. Francesco Buranelli schreibt hierzu: "A Giulio II, o Julus, come viene chiamato dai suoi contemporanei, il ritrovamento della statua del Laocoonte fornirà lo spunto per avviare a mettere in atto l'articolato programma autocelebrativo che realizzerà, negli anni a seguire, al rientro nel 1507 dalla campagna militare a Bologna. L'acquisizione del Laocoonte fu, inoltre, l'occasione per il pontefice di trasferire in Vaticano alcune sculture di sua proprietà e di acquistarne altre, tutte collegate ai temi virgiliani della distruzione di Troia, della nascita di Roma e della discendenza divina della gens Iulia, e destinate alla magnificazione di Giulio II come nuovo fondatore di Roma"21.
Die Laokoongruppe war in der alten Ergänzung mit dem erhobenen rechten Arm des Laokoon (wie im hier betrachteten Gipsabguss) wesentlich höher gewesen. In der neuen Ergänzung durch Filippo Magi, die Sie hier im Dia 5 sehen, mit dem von Ludwig Pollak 1903 gefundenen (siehe unten Anm. 67), originalen rechten Arm des Laokoon, betragen ihre Maße: H. "208 x 163 x 112 cm" (vergleiche F. Buranelli et al. 2006, 119, scheda 1 [P. Liverani]). Die Gruppe zeigt demnach die dargestellten Figuren, Laokoon und seine Söhne, in überlebensgroßem Maßstab. Aus dieser Tatsache können wir ableiten, dass auch die beiden Schlangen der Gruppe überlebensgroß dargestellt sein müssen.
Auch vor uns ist bereits der Versuch unternommen worden, die Laokoonschlangen abzumessen. So bezifferte Friedrich Brein die Länge der Schlangen mit 7,30 m und 6,70 m, Götz Lahusen22 ist ihm darin gefolgt, während Susanne Muth23 ihre Längen als 6-7 m messend angenommen hat.
Ich habe dann (2002) zunächst mir zugängliche Fachliteratur gelesen (siehe meine Bibliographie), und bin zu dem Schluß gelangt, dass es sich bei den Laokoonschlangen um Giftschlangen oder Riesenschlangen handeln müsse, da ich davon ausging, dass die Laokoonschlangen den Laokoon und seinen jüngeren Sohn mit ihren Bissen töten. Denn Riesenschlangen haben keine Giftzähne, sie beißen zwar, aber nicht, um ihre Opfer zu töten.
Mit Photos der Laokoongruppe und diesen rudimentären Vorstellungen ausgestattet, haben Franz Xaver Schütz und ich dann am 29. Mai 2002 Herrn Prof. Dr. Wolfgang Böhme zu unserem ersten `Schlangengespräch´ aufgesucht: Er ist Herpetologe am damals so genannten Zoologischen Forschungsinstitut und Museum A. Koenig in Bonn (heute: Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig).

7. Dia. Darstellungen des Laokoon-Mythos in der römischen Wandmalerei. Links: aus Pompeji, Haus des Laokoon, Neapel, Museo Archeologico Nazionale (Inv. Nr. 111210). Rechts: Pompeji, Haus des Menander (I.10.4) Aus: F. Buranelli et al. 2006, 25, Figs. 5; 424.
Mir ging es bei den Geprächen mit Prof. Böhme am 29. Mai und 13. November 2002, sowie in unserer anschließenden Email-Korrespondenz zum Thema darum herauszufinden, ob die Darstellung der Laokoonschlangen auf Naturbeobachtungen beruhen, und wenn ja, auf welchen.
Bei unseren `Schlangengesprächen´ mit Herrn Prof. Böhme
ist Folgendes herausgekommen
So etwas wie die Grate25 in der Mitte der Schlangenkörper, wie sie an den Laokoonschlangen und weiteren plastischen antiken Schlangendarstellungen dort zu beobachten sind, wo sich ihr Rückgrat befindet, gibt es in der Natur in dieser Form überhaupt nicht. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass diese Grate, weil sie die Mittellinien der Schlangenkörper markieren, vielleicht als Leitlinien bei der farbigen Fassung derartiger Skulpturen gedient haben. Dann habe ich Prof. Böhme die hier auf dem Dia 7 gezeigten römischen Wandmalereien mit der Darstellung der Laokoongeschichte gezeigt. Sein Urteil: Das seien gar keine Schlangen, zumindest keine, vor denen in einer realen Situation Laokoon und seine Söhne hätten Angst haben müssen.
Im Übrigen töten Schlangen ihre Opfer, um sie zu fressen, wie uns Prof. Böhme beim Anblick dieser Malereien erklärt hat. Szenarien wie sie hier zu sehen sind, nämlich, dass eine Schlange nacheinander mehrere Opfer tötet, anstatt nur das erste, um es dann sofort zu verschlingen, gibt es in der Natur nicht.
Links auf dem Dia 7 erscheint die Malerei aus der Casa di Laocoonte: Links im Vordergrund liegt der jüngere Sohn Laokoons nackt und regungslos auf dem Rücken am Boden - er ist offenbar bereits von einer der beiden Schlangen getötet worden. Rechts im Vordergrund stürzt der ältere Sohn ins Knie, er versucht vergeblich, sich gegen eine der beiden Schlangen zu wehren. Laokoon, der sich links im Hintergrund auf den Altar seines Gottes geflüchtet hat, wird von der anderen Schlange angegriffen. Rechts auf dem Dia 7 sehen wir den bereits getöteten älteren Sohn rechts im Vordergrund liegen, ganz links am Bildrand kämpft der jüngere Sohn Laokoons mit einer der Schlangen, während die andere Schlange den im Hintergrund links befindlichen Laokoon überfallen hat. Das Thema dieser Darstellungen ist ja natürlich ein ganz anderes als die Schilderung des natürlichen Verhaltens von Schlangen: Was wir hier sehen, sind Wiedergaben der mythologischen Laokoongeschichte.
Ich zeige Ihnen diese beiden Wandmalereien auf Dia 7 aber auch aus einem ganz anderen Grund. Hier sehen wir nämlich den trojanischen Priester Laokoon nicht nur vollständig bekleidet, sondern auch, zumindest in der Fassung des Mythos in der Casa di Laocoonte, wie es sich für einen Priester normalerweise gehört, sogar mit sehr kostbaren Gewändern angetan.
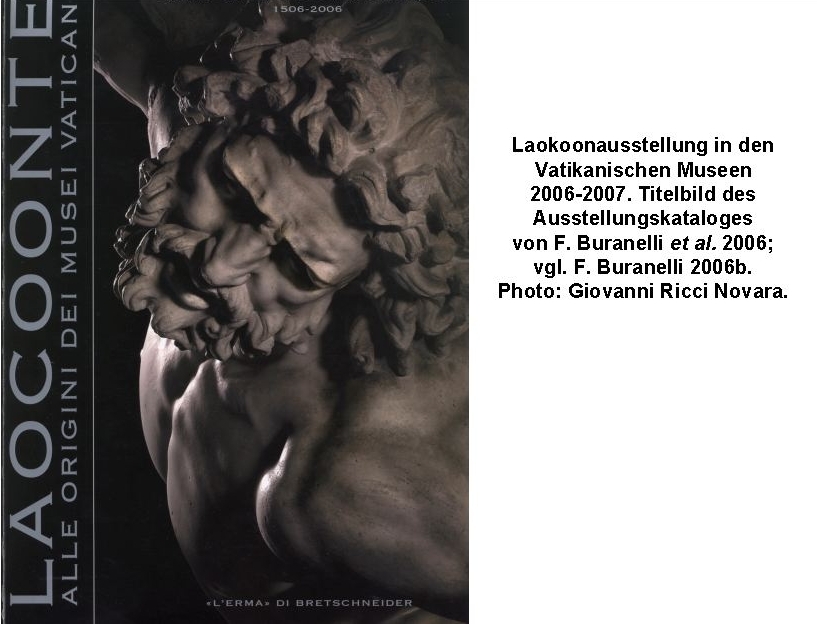
8. Dia. Laokoonausstellung in den Vatikanischen Museen 2006-2007. Titelbild des Ausstellungskataloges von F. Buranelli et al. 200626; vergleiche F. Buranelli 2006b. Photo: Giovanni Ricci Novara.
Dagegen ist der Laokoon der Vatikanischen Gruppe nahezu unbekleidet. Er hatte offenbar, ebenso wie seine Söhne, einen Chiton getragen, doch auf Grund ihres Kampfes mit den Schlangen - wie die Betrachter wohl schließen sollen - sind nun alle drei Protagonisten der Gruppe mehr oder weniger komplett nackt, da ihre Kleidung, im Laufe des Ringens mit den Schlangen, abgestreift worden ist. Nur der Lorbeerkranz sitzt dem Laokoon noch `unverrückt´ auf dem Kopf. Dieses ikonographische Detail hielten die Künstler demnach für sehr wichtig - und uns ermöglicht dieser Kranz, neben anderen Details der Darstellung, die Version der Laokoongeschichte zu identifizieren, welcher der Auftraggeber und seine Künstler gefolgt sind (darauf werde ich unten, zu Dia 48, noch einmal zurückkommen).
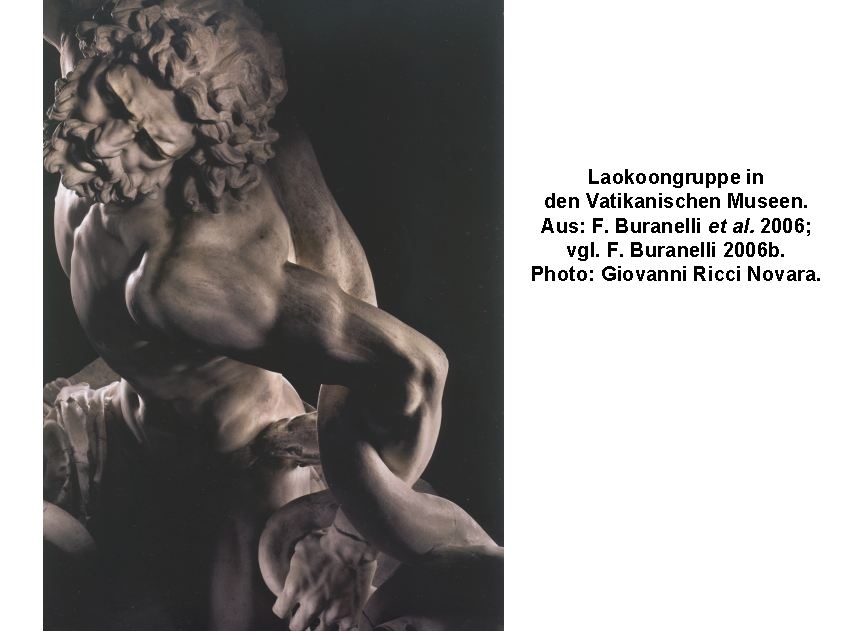
9. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Aus: F. Buranelli et al. 2006; vergleiche F. Buranelli 2006b. Photo: Giovanni Ricci Novara.
Natürlich ermöglicht den Künstlern erst das Fehlen von entsprechenden Gewändern des Priesters, den Biss der `oberen´ Schlange in Laokoons linker Hüfte äußerst wirkungsvoll zu inszenieren (wie auch den Biss der `unteren´ Schlange in die Seite des jüngeren Sohnes). Und, was gleichfalls nicht vergessen werden sollte: Dank dieser Kunstgriffe konnten die Künstler auch die Schönheit der Körper ihrer drei Protagonisten vorführen. - Dazu werde ich unten, bei der Diskussion von Caravaggios Gemälde `Junge, von einer Eidechse gebissen´ (Dia 27.B) noch einmal zurückkommen.
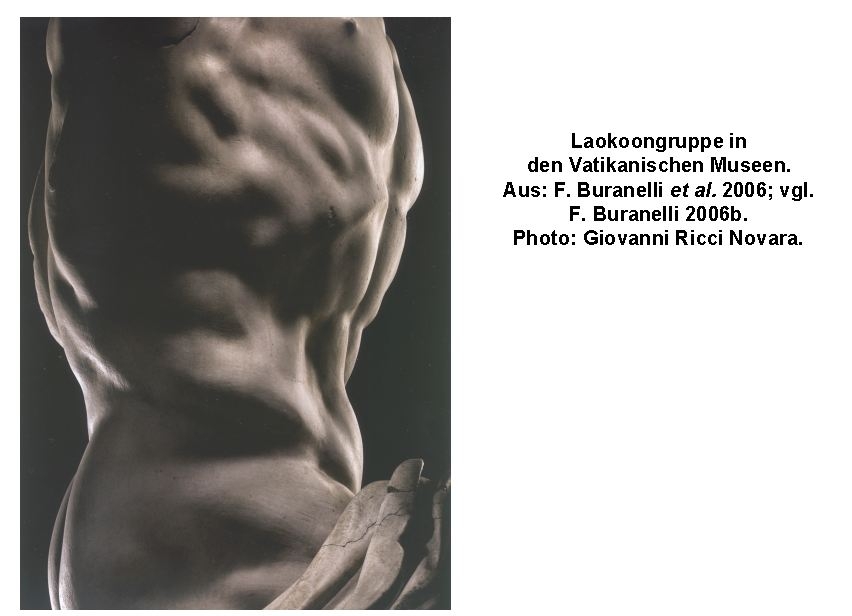
10. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Aus: F. Buranelli et al. 2006; vergleiche F. Buranelli 2006b. Photo: Giovanni Ricci Novara.
Hinzu kommt, dass auf diese Weise die - als sehr schön charakterisierten - entblößten Körper der drei Protagonisten der Gruppe mit großer Emphase vorgeführt werden konnten.
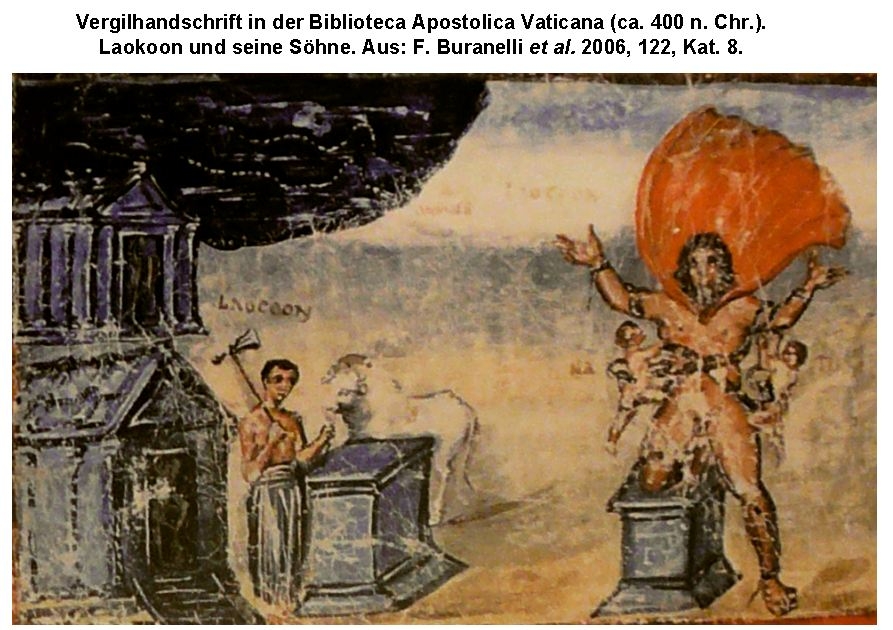
11. Dia. Vergilhandschrift in der Biblioteca Apostolica Vaticana (circa 400 n. Chr.). Laokoon und seine Söhne. Aus: F. Buranelli et al. 2006, 122, Kat. 827.
Wenn man die Gestalt der Laokoonschlangen und deren Länge betrachtet, kommen als Vorbild (theoretisch) Giftschlangen nicht in Frage, denn diese werden nur bis circa 4 m lang, die meisten Giftschlangen sind jedoch sehr viel kürzer - wobei aber auch Giftschlangen wesentlich dicker als die Laokoonschlangen wären, wie wir dann in den Gesprächen mit Prof. Böhme erfahren sollten.
Ergo müßten die Laokoonschlangen Riesenschlangen sein, wie bereits verschiedene Gelehrte28 vorgeschlagen hatten, wobei aber bereits Brein darauf hinwies, dass die Körper der Laokoonschlangen wesentlich schlanker als jene von Riesenschlangen gebildet sind. Hinzu kommt ihr enormes Gewicht: Eine 10 m lange Riesenschlange wiegt 200 kg29, und beide Laokoonschlangen zusammen sind mehr als 12 m lang. Obwohl der Laokoon der Gruppe in den Vatikanischen Museen für einen Priester (also einen `Intellektuellen´) und obendrein noch `Familienvater´ mittleren Alters noch ausgesprochen jugendlich-athletisch wirkt, würde selbst er unter dem Gewicht von 200 kg mit Sicherheit zusammenbrechen.
Wie Riesenschlangen ihre Opfer `ergreifen´ und verschlingen:
Dieser Vorgang gliedert sich in 3 Phasen:
Sie beißen ihr Opfer, um es zu `ergreifen´ und festzuhalten (Phase 1), umschlingen seinen Thorax, um es zu ersticken (Phase 2), und wenn der Tod des Opfers eingetreten ist, verschlingen sie das Opfer (Phase 3). Phase 1 und 2 erfolgen blitzschnell
Wie uns Herr Prof. Böhme anhand von Ausstellungsstücken von Riesenschlangen im Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig und anhand der entsprechenden Fachliteratur gezeigt hat, ist die Annahme, bei den Laokoonschlangen handele es sich womöglich um Riesenschlangen, wegen des abweichenden Körperbaus und Verhaltens von Riesenschlangen, aber ebensowenig möglich.
Riesenschlangen haben einen vergleichsweise `plumpen´ Körper, sie beißen ihr Opfer, um es zu `ergreifen´ und festzuhalten (Phase 1), umschlingen seinen Thorax, um es zu ersticken (Phase 2), und wenn der Tode des Opfers eingetreten ist, was Schlangen, die taub sind, nicht hören, dafür aber fühlen können, verschlingen sie das Opfer (Phase 3).
Wie uns Herr Prof. Böhme des Weiteren erklärt hat, "sind bei der Riesenschlange, wenn etwas als Beute angesehen wird, der Würgereflex und der Umschlingungsreflex an den Biss gekoppelt - sie würgen das Opfer, bis dessen Tod eintritt"30.
Interessanterweise zeigt der Künstler, der den Vergilkodex in der Vatikanischen Bibliothek illustriert hat - was Sie jetzt im Dia 10 sehen - dass die Schlange den Thorax des Laokoon umwunden hat, allerdings nur ein einziges Mal.
In Wirklichkeit müßten die Schlangen aber, wie uns Herr Prof. Böhme erklärt hat, wenn es denn Riesenschlangen in realistischer Darstellung wären, die Laokoon und seine Söhne töten wollen, Laokoons Brustkorb und die der Söhne komplett, das heißt, mit mehreren Windungen ihrer Körper umschlingen (Phase 2). Anschließend müssten diese Riesenschlangen ihre Opfer selbstverständlich sofort verschlingen (Phase 3).
Wenn wir dieses Szenario weiterdenken wollen, dann wären Laokoon und seine Söhne demnach in den Phasen 2 und 3 des Geschehens aus unterschiedlichen Gründen für uns, die Betrachter der Gruppe, fast nicht mehr, beziehungsweise gar nicht mehr sichtbar (!).
Wobei es aber ein Problem gäbe: Jede der Schlangen könnte nur ein Opfer verschlingen. Bliebe also nur übrig, Phase 1 des Geschehens zu zeigen: den Schlangenbiss. In der Realität beisst eine Riesenschlange nur ein Opfer auf einmal: Hier sind es, dem Mythos zufolge, zwei Schlangen und drei Opfer, was in der Realität natürlich gar nicht geht. Mit Hilfe der `Knoten´ ihrer Schlangen haben die Künstler dieses Hindernis klug `überbrückt´ und von dieser Tatsache abgelenkt.
Da in der Laokoongruppe nicht dargestellt wurde, wie Riesenschlangen
tatsächlich Beute fangen und töten, beweist dies also, dass es den Künstlern
bei ihrer Darstellung um etwas ganz anderes ging
Auch `Knoten´ machen Schlangen in Wirklichkeit nicht,
wie uns Herr Prof. Böhme des Weiteren erklärt hat
Im Übrigen sei "die Fähigkeit, sich zu wickeln, auf Kletternattern und Riesenschlangen beschränkt"31. Wenn wir diese Beobachtungen zusammenfassen, bedeutet dies, dass die Gestaltung der Laokoonschlangen unter anderem32, aber eben nicht ausschließlich, auf entsprechenden Naturbeobachtungen basiert. Prof. Böhme sagte uns in diesem Gespräch aber auch Folgendes: "Riesenschlangen könnten auch einem Mann wie dem Laokoon Brustkorb und natürlich den Hals zudrücken".
Bereits Magi33 hatte im Übrigen die `Knoten´ der Laokoonschlangen dahingehend gedeutet, dass die Tiere auf diese Weise nicht nur ihre Opfer an jeglicher Gegenwehr hindern, sondern sie gleichzeitig durch Ausübung ihrer Muskelkraft schwächen.
Die Tatsache, dass Schlangen in Wirklichkeit keineswegs mit ihren Körpern `Knoten´ um ihre Opfer machen, war auch der Grund, weshalb Prof. Böhme bei unserem ersten Gespräch, beim Anblick der Photographien der Laokoongruppe sagte: "Ich habe mich immer gefragt, warum die sich so aufregen" - denn dass die drei Protagonisten der Laokoongruppe von den Schlangen mit diesen `Knoten´ buchstäblich gefesselt worden sind, hatte er zuvor an den Photos der Gruppe, die er kannte, nicht beobachtet.
Mit dieser Bemerkung brachte Prof. Böhme demnach Folgendes zum Ausdruck. Er, als Herpetologe, hatte, beim Anblick von Photos der Laokoongruppe, immer den Eindruck gehabt, dass in einer realen Situation diese drei Männer, nach ihrer eigenen Physis zu urteilen, und wenn man gleichzeitig die Gestalt der beiden Laokoonschlangen berücksichtigt, problemlos in der Lage hätten sein müssen, sich eines Angriffs derartiger Schlangen zu erwehren. Wie wir gleich sehen werden, hat Prof. Böhme das nun auch in einem Aufsatz festgestellt, in dem er die Schlangen der Laokoonschlange behandelt hat; vergleiche W. Böhme und T. Koppetsch (2021, 495).
Ganz ähnlich hatte sich bereits der Klassische Archäologe Götz Lahusen zum Laokoon geäußert.
Lahusen hat, im Unterschied zu allen übrigen mir bekannt gewordenen publizierten Meinungen von Archäologen, welche ausnahmslos die, wie sie schreiben, `grauenvolle´ Wirkung der Darstellung auf sich selbst beschrieben haben, über den Laokoon lapidar bemerkt:
"... dieser überaus kräftige Mann, den die Schlangen eigentlich nur mäßig belästigen [Hervorhebung von mir]" 34.
Zwischenbilanz
Lange nachdem dieses Kapitel bis zu diesem Punkt geschrieben war, hat mir Wolfgang Böhme freundlicherweise den Aufsatz geschickt, den er zusammen mit Thore Koppetsch (2021) verfasst hat, in dem sich beide auch zu den Schlangen der Laokoongruppe äußern. Beide wiederholen, was Prof. Böhme bereits in den Gesprächen mit Franz Xaver Schütz und mir betont hatte: Dass, in der Realität, Schlangen dieser Größe den drei Männern der Laokoongruppe gar nichts anhaben könnten. Des Weiteren bestätigen mir beide Autoren, dass meine in den Kapiteln I. und I.1. gemachten Bemerkungen zu den Schlangen der Laokoongruppe aus herpetologischer Sicht korrekt seien.
Wolfgang Böhme und Thore Koppetsch ("Snake names in the Greek-Roman antiquity: old characterizations, identity in current zoology, and change of their original meaning in post-Linnean herpetology", 2021, 495) schreiben :
"Snakes in antique performing arts
Most paintings and sculptures containing or representing snakes are similarly mythically overloaded as are the literarian testimonies and sources dealt with above. Examples are the snake reliefs at the Pergamon altar in Berlin or the famous LAOKOON group in the Vatican museum in Rome (Fig. 25). In the latter, the snakes trying to constrict Laokoon and his sons are not big enough to be a real danger for these three men who nonetheless seem to surrender themselves in their fate. These obviously constricting (i.e. most likely non-venomous) snakes came out of the sea what qualifies them already as mythical creatures. In fact constricting snakes, particularly boas and pythons, start to become dangerous for humans only from four to five meters upwards in length, and even if one of the snakes has been measured as being more than 6 m long (Häuber, in press), it is much too thin as that it could be strong enough for strangling these three men. In this paper, Chrystina Häuber performed a particularly thorough and detailed analysis of the LAOKOON group including interpretations of the sculptured snakes, also in respect to herpetological knowledge [Hervorhebung von mir]".
Böhme und Koppetsch (2021, 498) zitieren mich in ihren "References" wie folgt:
Häuber, C. (in press): Die Laokoon-Gruppe im Vatikan – drei Männer und zwei Schlangen: „Ich weiß gar nicht, warum die sich so aufregen“ (Wolfgang Böhme). Die Bestätigung von F. Magis Restaurierung der Gruppe und der Behauptungen, sie sei für die Horti des Maecenas, später Domus Titi, geschaffen, und dort entdeckt worden. – FORTVNA PAPERS, Munich".
Noch später ist mir folgender Kommentar Filippo Coarellis ("Sperlonga e Tiberio", 1996, S. 500 = Wiederabdruck seiner Rezension 1973 von R. Hampe (Sperlonga und Vergil, 1972) zu Hampes Beurteilung der `oberen´ Schlange der Laokoongruppe aufgefallen:
"Molto convincente mi sembra invece la ricostruzione [von R. Hampe 1972] della posizione del serpente che attacca il padre [das heißt, Laokoon], la cui testa non va posta sul fianco sinistro, come nel restauro cinquecentesco [wie wir unten sehen werden, basiert diese Restaurierung aber auf dem sicheren Befund des Schlangenkopfes an Laokoons linker Hüfte], ma emergeva al di sopra della spalle destra [Laokoons]: ciò spiega la convulsione patetica del volto e la torsione violenta del corpo, conseguente allo sforzo di allontanare dal viso il morso letale del serpente. La posizione della statua viene ad essere così molto meno arbitraria e ingiustificata di quanto non appare ora [Hervorhebung von mir]".
Coarellis Text beweist, dass sich weder Hampe (1972), noch Coarelli selbst (1973/ 1996) mit dem tatsächlichen Verhalten von Riesenschlangen beschäftigt haben. Wie oben im Detail beschrieben, ist die `Reihenfolge´ der Aktionen einer Riesenschlange genau umgekehrt von der, die Hampe und Coarelli hier voraussetzen, die offensichtlich von der Prämisse ausgehen, dass diese Schlangen ihre Opfer zunächst umwinden, und erst danach zubeißen. Auch Susanne Muth (2017b, 340-341, wörtlich zitiert oben, in Anm. 30), folgt diesem Fehlurteil.
In Wirklichkeit (siehe W. Koch 1927, 123-24, ebenfalls oben, Anm. 30) müssen Riesenschlangen, die ja keine Hände haben, ihr Opfer als erstes beißen, um es überhaupt `festhalten´ zu können, gleichzeitig umschlingen sie das Opfer mit einigen Windungen ihres Körpers, um es zu ersticken, und sobald der Tod des Opfers eingetreten ist, fressen sie es auf. Auch Götz Lahusen (1999, 300) hatte schon richtig erkannt, wie Schlangen beim Beutemachen vorgehen, außerdem wußte auch er, dass die `obere´ Schlange den Laokoon in seine linke Hüfte beißt; er bildete als seine Abb. I den "Rekonstruktionsvorschlag der Gruppe von Roland Hampe" (1972, Taf. 36) ab.
Siehe unten, in den Kapiteln I.1. und II., sowie die Dias 19; 20; 25; 26; 27.A und 38, zu den Tatsachen, dass, wie Francesco Buranelli am 26. April 2018 vor dem Original gesehen hat, die Künstler der Laokoongruppe von beiden Schlangen nur ihre Oberkiefer dargestellt haben, und dass die Bosse an der linken Hüfte Laokoons beweist, dass ihn die `obere´ Schlange an dieser Stelle beißt.
Fahren wir nun fort mit der Zusammenfassung unserer Schlangenforschungen.
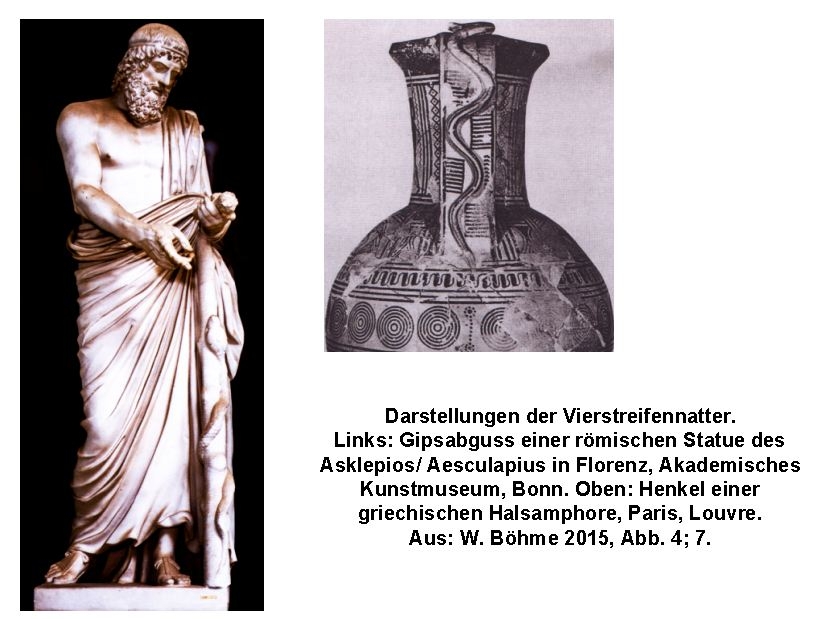
12. Dia. Darstellungen der Vierstreifennatter. Links: Gipsabguss einer römischen Statue des Asklepios/ Aesculapius in Florenz, Akademisches Kunstmuseum Bonn. Oben: Henkel einer griechischen Halsamphore, Paris. Louvre. Aus: W. Böhme 2015, Abb. 4; 7.
Die schlanke Gestalt der Laokoonschlangen, ihre Beweglichkeit und Geschmeidigkeit, sowie ihre eleganten Bewegungen sind vielmehr, wie uns Prof. Böhme erklärt hat, die einer Schlangenart, welche wissenschaftlich Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789), Vierstreifennatter35, heißt. Diese Schlange wird bis 2,60 m lang, und ist auch uns Altertumswissenschaftlern bestens bekannt: Es handelt sich um die Schlange des Asklepios. Sie sehen hier Exemplare dieser Schlangenart am Gipsabguss einer römischen Marmorstatue des Gottes Asklepios/ Aesculapius, und am Henkel einer griechischen Halsamphore36, auf der auch ihr typisches, von Fachleuten sogenanntes `Zeichnungsmuster´ angegeben ist, das zur Namensgebung `Vierstreifennatter´ geführt hat.
Der Gott Asklepios stützt sich in der links wiedergegebenen Statue in Florenz auf seinen berühmten `Asklepiosstab´/ `Aesculapstab´, um den sich seine Schlange windet. Otto Keller deutete dieses Attribut des Asklepios wie folgt: Er habe "auf Kultbildwerken regelmäßig die Baumschlange bei sich", und schrieb an anderer Stelle: "Asklepios ist der Schlangenmann oder Schlangengott"37, wobei er darauf hinwies, dass der Gott auch mit seiner Schlange identifiziert werden konnte (vergleiche hier, Dia 13). Vierstreifennattern werden nicht nur seit der Antike verehrt, sie sind auch besonders harmlos, so beißen sie zum Beispiel niemals Menschen - selbst in eigens zu diesem Zweck unternommenen Laborversuchen hat man die Tiere niemals dazu veranlassen können38.
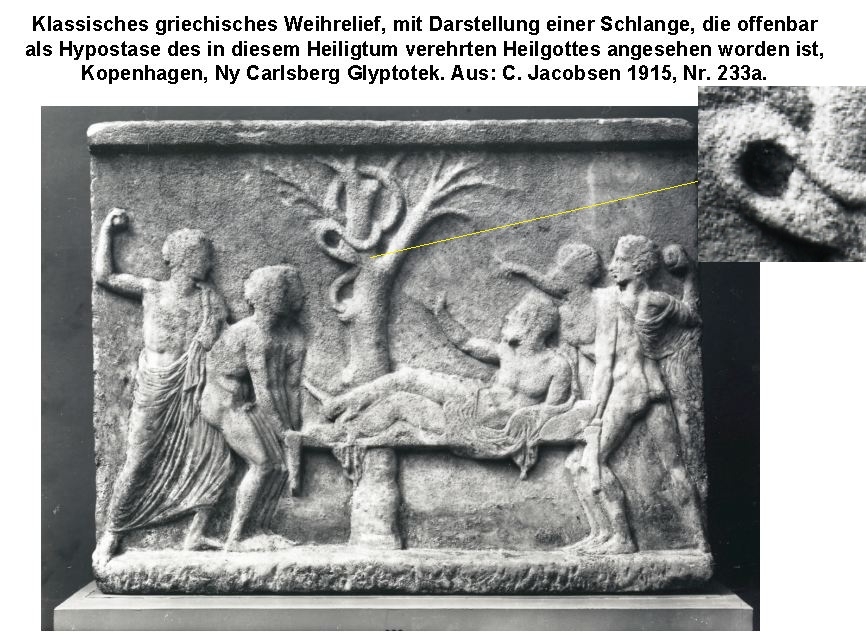
13. Dia. Klassisches (attisches?) griechisches Weihrelief mit Darstellung einer Schlange (einer Vierstreifennatter) die offenbar als Hypostase39 (Personifizierung) des in diesem Heiligtum verehrten Heilgottes angesehen wurde. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek. Aus: C. Jacobsen 1915, Nr. 233a. Im Kasten oben rechts sehen Sie einen vergrößerten Ausschnitt dieses Reliefs: Den Kopf der Schlange, die sich dem kranken Mann auf der Bahre, der sie anruft, zuwendet. Der Mann scheint der Schlange in seiner erhobenen, rechten Hand etwas anzubieten, in Ei?
Obwohl auch das Geschehen sehr interessant ist, das auf diesem klassischen (attischen?) griechischen Weihrelief in der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen geschildert wird, zeige ich es Ihnen hier vorrangig aus einem ganz anderen Grund. Dieses Relief dokumentiert das Aussehen und Verhalten einer in Griechenland in der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Heiligtum eines Heilgottes lebenden Schlange, einschließlich der Größe dieses Tieres, im Vergleich zu den ebenfalls auf diesem Relief erscheinenden Männern, die, wie im Falle der Laokoongruppe, verschiedenen Altersklassen angehören. Wie Küster40 überzeugend vermutete, der dieses Relief zuerst publiziert hat, wurde der in diesem Heiligtum verehrte Heilgott mit dieser Schlange identifiziert.
Nach der hier vorgetragenen Hypothese hatten ja die Künstler der Laokoongruppe als Vorbild für die Schlangen ihrer Skulptur Exemplare eben dieser heimischen Schlangenart ausgewählt - dann nämlich, wenn es sich auch im Fall des auf dem Dia 13 gezeigten klassischen (attischen?) griechischen Weihreliefs tatsächlich um die Darstellung einer Asklepiosschlange handelt. Küster war offenbar dieser Ansicht. - Und Herr Prof. Böhme hat das bestätigt (siehe oben, Anm. 39)
Bekanntlich wurden ja lebende Exemplare der Asklepiosschlange in den Heiligtümern des Asklepios gehalten (und später auch in den Heiligtümern des römischen Aesculapius)41, weshalb ich auch deshalb Küsters Vorschlag für plausibel halte. Die Größe der auf diesem Relief dargestellten Schlange, die Tatsache, dass sie als guter Kletterer charakterisiert wird, und, wie wir gleich sehen werden - besonders die Freundlichkeit dieser Schlange42 - sprechen ebenfalls für diese Identifizierung.
Wir sollten aber Folgendes Bedenken: Als Küster sein Werk schrieb (1913), hielt man noch die deshalb so genannte Äskulapnatter für die Schlange des Asklepios, während letztere heute mit einer anderen Schlangenart, der Vierstreifennatter, identifiziert wird. Was ihre Gestalt betrifft, sind sich beide Schlangenarten sehr ähnlich, auch sind beide gute Kletterer. Keller43, der noch die Äskulapnatter für die Schlange des Asklepios hielt, nannte sie ja, wie wir oben bereits gehört haben, eine `Baumschlange´. Da die Vierstreifennatter aber sehr freundlich ist, was für die Äskulapnatter keineswegs zutrifft, und, wie wir noch sehen werden, die freundlichen Vierstreifennattern nachweislich in den antiken Heiligtümern des Asklepius und Aesculapius gehalten worden sind, folge ich Küster in der Annahme, in der auf diesem griechischen Relief gezeigten - sehr freundlichen - Schlange, die Asklepiosschlange zu erkennen. Nur dass man heute weiß, dass es sich hierbei nicht um die Schlangenart Äskulapnatter gehandelt hat (wie man zu Küsters und Kellers Zeiten annahm), sondern dass man diese Schlange statt dessen mit einer Vierstreifennatter identifizieren muss (auf diese beiden, hier genannten Schlangenarten, werde ich unten noch einmal zurückkommen)44.
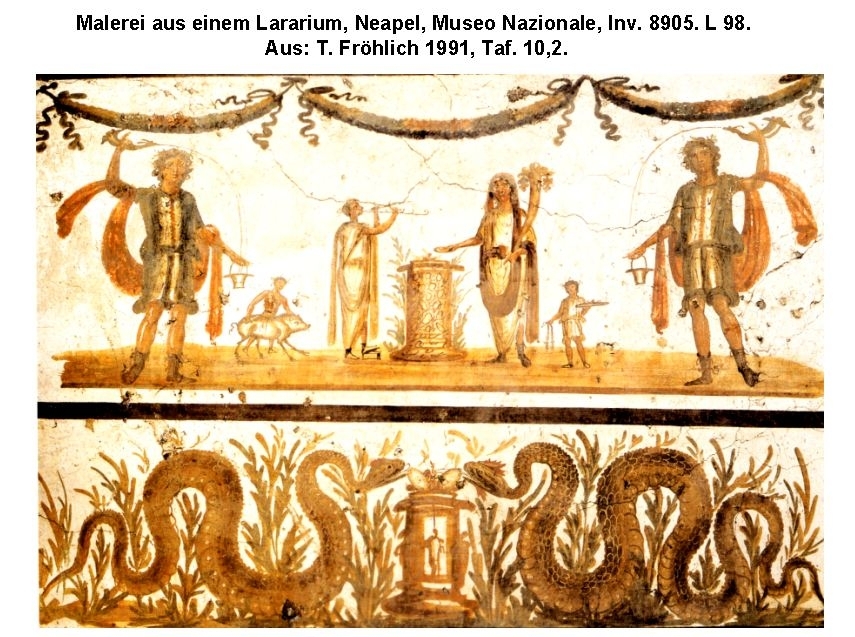
14. Dia. Malerei aus einem Lararium, Neapel. Museo Archeologico Nazionale, Inv. 8905. L 98. Aus: T. Fröhlich 1991, Taf. 10,2.
Unter den zahlreichen römischen Darstellungen der Asklepiosschlange/ Vierstreifennatter sind uns Altertumswissenschaftlern besonders die aus Lararien geläufig. Sie sehen unten zwei dieser Tiere, die sich auf Eier zu bewegen, die Keller45 als ihre Lieblingsspeise bezeichnet hat. Die rechts sichtbare Schlange ist (angeblich) ein männliches Tier, was man nach Keller46 daran erkennen kann, dass es einen `Kamm´ auf dem Kopf hat, das links sichtbare sei dagegen, weil es keinen `Kamm´ besitze, (angeblich) ein weibliches Tier. Ich kenne diese Wandmalerei leider nicht aus eigener Anschauung, bin aber der Auffassung, dass sie hier korrekt wiedergegeben sein muss: Weil der rechts vom Altar stehende Genius, der eine Opferschale über den Altar hält, mit seine rechten Hand opfert; eine Annahme, die sich bestätigt hat47. Wir werden auf Dia 15 noch einmal ein Detail dieser Wandmalerei sehen, den Kopf der auf diesem Bild rechts erscheinenden `männlichen´ Schlange.
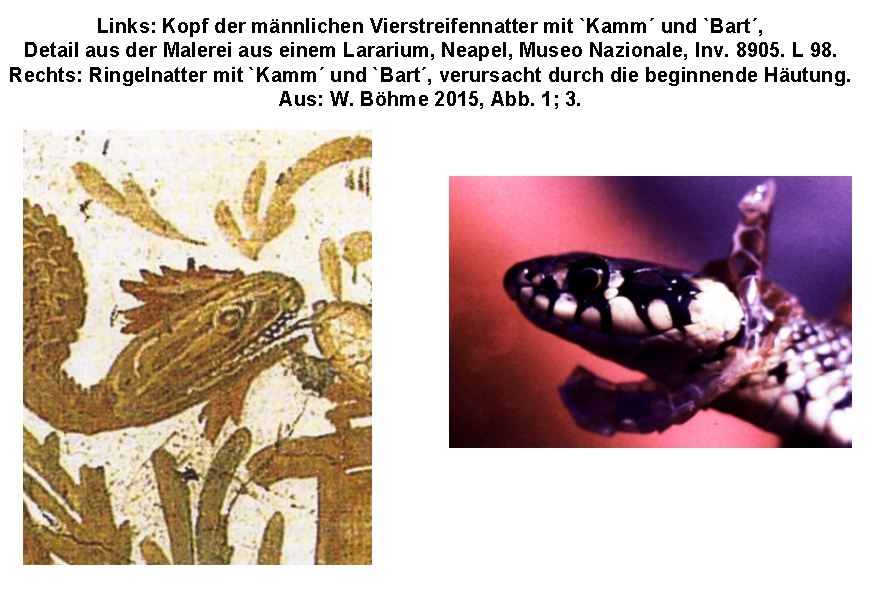
15. Dia. Links: Kopf der (angeblich) männlichen Vierstreifennatter aus der eben gezeigten römischen Wandmalerei, mit `Kamm´ und `Bart´. Rechts, sich häutende Ringelnatter. Aus: W. Böhme 2015, Abb. 1; 3.
Ich hatte Herrn Prof. Böhme anläßlich unseres ersten Gesprächs48 antike Schlangendarstellungen mit `Kamm´ und `Bart´ gezeigt, und ihn gefragt, ob diese Darstellungskonventionen auf Naturbeobachtung beruhen. Dazu ist aber von vornherein zu bemerken, dass nicht alle griechischen und römischen Künstler ihre Schlangen mit `Kamm´ und `Bart´ versehen haben - was allein schon die hier gewählten Schlangenbilder zeigen. Wie Sie aus Böhme's neuester Publikation zum Thema (2015) ersehen können, ist dies tatsächlich der Fall. Sie sehen links das angekündigte Detail aus der eben gezeigten Malerei aus einem Lararium, mit dem Kopf der rechten, (angeblich) männlichen Schlange49: Sie hat einen solchen `Kamm´ und `Bart´.
Böhme hat beide Darstellungskonventionen wie folgt erklärt: "Am Anfang dieses periodisch stattfindenden Häutungsvorgangs steht das Aufplatzen der alten Haut entlang der Ränder von Ober- und Unterkiefern, wodurch die Häutungshülle über dem Kopf noch oben, an den Unterkiefern aber nach unten umgestülpt wird, was in der römischen Malerei oft als Kamm und Bart am Schlangenkopf dargestellt wurde ([mit Angabe von Literatur]; vergleiche Abb. 1 [auf Dia 15, links]), wobei das starre, transparente Deckschildchen über dem Auge, die sogenannte ``Brille´´ der Schlange, dieses kurz vor der Häutung milchig trüb erscheinen lässt (Abb. 2), bevor es nach dem Abstreifen der Exuvie wieder klarsichtig erscheint (Abb. 3 [auf Dia 15, rechts]). Die antike Darstellung kamm- und bartbewehrter Schlangenköpfe ist also durch das natürliche Original leicht nachzuvollziehen"50.
Weil ich zuvor noch nicht hatte klären können, warum manche antiken Schlangendarstellungen `Kamm´ und `Bart´ aufweisen, andere dagegen nicht, hatte ich die Ergebnisse unserer `Schlangengespräche´ mit Prof. Böhme im Jahre 2002 in meinen früheren Publikationen zur Laokoongruppe noch nicht erwähnt. Ich hatte mir diese Fragen natürlich in Bezug auf die Schlangen der Laokoongruppe gestellt. Nachdem ich seither mehr Beispiele antiker Schlangendarstellungen kennen gelernt habe, und auf Grund der im Folgenden geschilderten Erkenntnisse, scheint es mir inzwischen aber ganz einfach erklärbar zu sein, warum die Laokoonschlangen keinen `Kamm´ und `Bart´ aufweisen: Und zwar allein schon deshalb nicht, weil an ihren Köpfen nur die Oberkiefer ausgebildet sind.
Dank der Beobachtungen von Francesco Buranelli am Original der Laokoongruppe51, wissen wir ja nun, dass die Künstler an den Köpfen der `unteren´ und der `oberen´ Schlange nur deren Oberkiefer dargestellt haben.
Im Übrigen scheinen die griechischen Künstler (zu denen auch die der Laokoongruppe zählen), deren Schlangendarstellungen wir hier bislang betrachtet haben52, `Kamm´ und `Bart´ von Schlangen insgesamt weniger häufig dargestellt zu haben, obwohl es natürlich Beispiele gibt. Keller hat in seiner oben zitierten Diskussion von Schlangenpaaren in römischen Lararien behauptet, dass nur jeweils die männliche Schlange mit einem `Kamm´ dargestellt worden sei, ob das auch für alle anderen griechischen und römischen Schlangendarstellungen mit `Kamm´ zutrifft, entzieht sich meiner Kenntnis.
Meines Wissens sind `Kamm´ und `Bart´ an Schlangen aber offenbar immer zusammen dargestellt worden. Falls die letztere Prämisse korrekt sein sollte, dann war die wichtigste Voraussetzung für die Entscheidung des entsprechenden Künstlers, eine Schlange mit `Kamm´ und `Bart´ darzustellen, also nicht etwa das Geschlecht des Tieres, sondern ein ganz anderes Kriterium, nämlich die Entscheidung der Frage, ob an der von ihm zu gestaltenden Schlange beides, nämlich Ober- und Unterkiefer, sichtbar sein sollten.
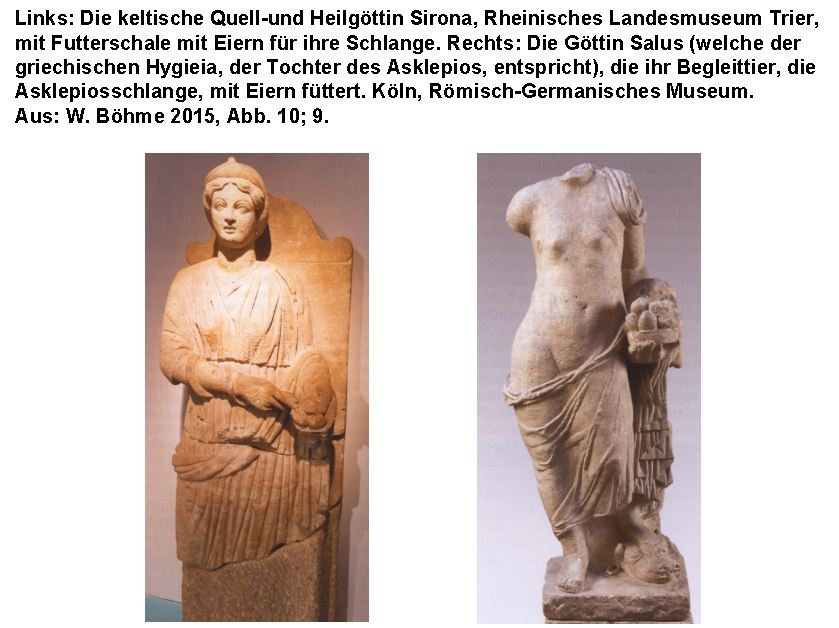
16. Dia. links. Die keltische Quell- und Heilgöttin Sirona, Rheinisches Landesmuseum Trier, mit Futterschale mit Eiern für ihre Schlange. Rechts: Die Göttin Salus (welche der griechischen Hygieia, der Tochter des Asklepios entspricht), die ihr Begleittier, die Asklepiosschlange, mit Eiern füttert. Köln, Römisch-Germanisches Museum. Aus: W. Böhme 2015, Abb. 10; 9.
Auch bei uns in Deutschland, zum Beispiel in den Museen von Trier und Köln, wo sich die hier gezeigten Skulpturen befinden, gibt es Darstellungen von römischen Göttinnen, die ihre Begleitschlangen mit Eiern füttern53.
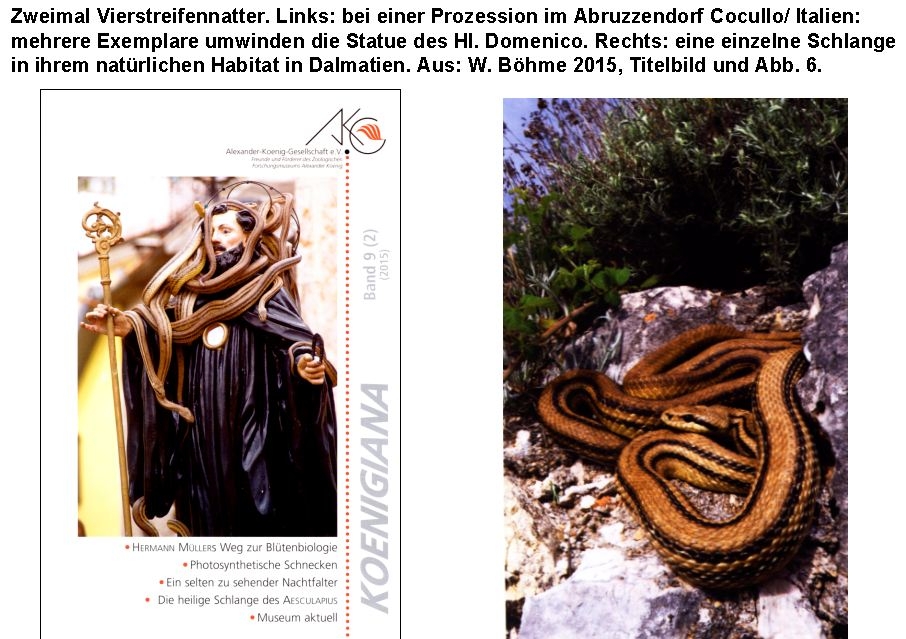
17. Dia. Zweimal Vierstreifennatter. Links: Bei einer Prozession im Abruzzendorf Cocullo/ Italien: mehrere Exemplare umwinden die Statue des Hl. Domenico. Rechts: Eine einzelne Schlange in ihrem natürlichen Habitat in Dalmatien. Aus: W. Böhme 2015, Titelbild und Abb. 8.
Während bei uns die Asklepiosschlangen/ Vierstreifennattern nicht mehr verehrt werden, spielen sie bei der alljährlichen Prozession zu Ehren des Heiligen Domenikus von Sora in Cocullo, einem kleinen Dorf in den Abruzzen, nach wie vor noch eine große Rolle (vergleiche Dia 17, links). Wir befinden uns hier in der `Marsica´, benannt nach den antiken Marsern - und die waren für ihre Gaukeleien mit Schlangen berühmt54. Rechts zeige ich Ihnen eine Vierstreifennatter in ihrem natürlichen Habitat in Dalmatien55. Es handelt sich um sehr schöne Tiere.
Ich selbst habe mich einmal 1965 bei einem Großbrand in Spanien mit Schwimmen durchs Meer gerettet - und dabei neben mir im Meer zwei Vierstreifennattern (wie ich jetzt zunächst irrtümlich glaubte) gesehen, die offensichtlich gleichfalls vor dem Brand der Macchia auf dem Steilufer ins Meer geflüchtet waren, und die hervorragend schwimmen konnten. - Wie ich dann aber von Herrn Prof. Wolfgang Böhme gelernt habe, waren das aber offensichtlich Schlangen, die nur ähnlich aussahen wie Vierstreifennattern56.
Auch bei Herrn Prof. Böhme im Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn haben Franz Xaver Schütz und ich am 29. Mai 2002 eine lebende Vierstreifennatter kennen gelernt, die in einem Terrarium dieses Museums lebte. Sie hat sich unglaublich schnell, geschmeidig, völlig geräuschlos und in ungemein eleganten Bewegungen um meinen linken Arm gewickelt, sich sehr hoch aufgerichtet und mich dabei angeschaut - das war ein sehr angenehmes Gefühl auf der Haut und ein wunderbares Erlebnis.
Übrigens, nicht nur die Erforschung der Laokoongruppe war langwierig und mühsam, auch die Erforschung der Asklepiosschlange hat sehr lange gedauert. So hat man bis in die 1980er Jahre jene Schlangen auf griechischen und römischen Darstellungen, die ich Ihnen soeben gezeigt habe, mit einer Schlangenart identifiziert, die wissenschaftlich Elaphe longissima (Laurenti, 1768) - Äskulapnatter57, genannt wird. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass die Asklepiosschlange mit der hier gezeigten Vierstreifennatter identifiziert werden muss58.

Dia 17.1. Goldmedaillon des Antoninus Pius. Dargestellt ist der Kulttransfer des Gottes Asklepios/ Aeskulap im Jahre 291 v. Chr. von Epidauros in Griechenland nach Rom: Wir sehen ein römisches Kriegsschiff (eine trireme), das die Asklepiosschlange (das heißt, den Gott selbst) von Epidauros abgeholt hat, und nun, auf dem Tiber flußaufwärts fahrend, nahezu sein Ziel erreicht hat. Die Asklepiosschlange liegt zusammengerollt auf dem Bug des Schiffes, das eben die Tiberinsel erreicht hat. Die Asklepiosschlange/ der Gott Asklepios wird vom Flußgott Tiber begrüßt. Angesichts der rechts vor ihr sichtbaren Tiberinsel wird sich die Asklepiosschlange im nächsten Moment vom Schiff ins Wasser gleiten lassen und zur Tiberinsel schwimmen, wo von Stund an (im Grunde bis heute) der Gott Asklepios/ Aesculapius verehrt werden sollte. Auch das Kriegsschiff hat sein Ziel erreicht: Es wird nach links hin gerudert, wo es bereits unter einem der Bögen der Navalia (des Kriegshafens im südlichen Marsfeld) verschwindet. Aus: F. Coarelli, LTUR III (1996) 419, Fig. 64: "Insula Tiberina. Medaglione di Antonino Pio. Cohen II, 271 N. 17 (da Gnecchi, Medaglioni romani II, tav. 43.1). Disegno da G. Bennier, L'Ile Tibérine dans l'antiquité (1902), fig. 19". - Vergleiche Häuber (2021/ 2023, 820-821, Fig. 107).
Herr Prof. Böhme hat am 29. Mai 2002, im Laufe eines der `Schlangengespräche´
mit Franz Xaver Schütz und mir, sehr treffend formuliert, dass es sich bei den
Laokoonschlangen um "unwahrscheinliche Kombinationsschlangen" handelt
Und zwar aus folgenden Gründen. Die Laokoonschlangen haben die Länge, und wie wir gleich sehen werden, auch die Schwanzform von Riesenschlangen, die Fähigkeit, sich zu wickeln (wie Riesenschlangen und Kletternattern), sowie die schlanke Gestalt, Geschmeidigkeit, Beweglichkeit und Eleganz von Vierstreifennattern, ihr Kopf ähnelt, wie wir gleich noch sehen werden, dem der Europäischen Eidechsennatter, und, wie diese Schlangenart, gehen die beiden Laokoonschlangen `zu zweit auf die Jagd´. Aber: Diese Schlangen beißen auch zwei der drei menschlichen Protagonisten der Gruppe, was Vierstreifennattern unter keinen Umständen tun würden, und sie fesseln ihre Opfer mittels `Knoten´ - wobei letzteres so in der Natur überhaupt nicht vorkommt.
Zuvor hatten wir noch ausgeschlossen, dass die Laokoonschlangen womöglich als Giftschlangen identifizierbar seien, da alle bekannten Giftschlangen sehr viel kürzer sind, noch, dass es sich um Seeschlangen handeln könnte. Das Fehlen von seitlichen Hautsäumen am Schwanz der `unteren´ Schlange zeigt, dass es sich bei ihr nicht um eine Seeschlange handelt59. In einigen Versionen der Laokoongeschichte heißt es ja, die beiden Schlangen seien, von den Göttern gesandt, übers Meer geschwommen, um Laokoon und seine Söhne zu töten60. Bei Betrachtung des ungewöhnlich langen, dünnen Schwanzes und der noch dünneren Schwanzspitze der `unteren´ Schlange hatte uns Prof. Böhme dann überdies darauf hingewiesen, dass dies typische Merkmale von Riesenschlangen seien.
Außerdem hatte ich Herrn Prof. Böhme gefragt, ob Schlangen überhaupt `zu zweit auf Jagd´ gehen - wie in den verschiedenen Versionen der Laokoongeschichte erzählt, und in der Laokoongruppe gezeigt. Wie uns Prof. Böhme mitgeteilt hat, ist das normalerweise nicht der Fall. Bei einer einzigen Schlangenart, der Europäischen Eidechsennatter (Malpolon monspessulanus), ist allerdings eine Paar-Bindung von Männchen und Weibchen bezeugt. Von dieser Schlangenart gibt es sogar ein sehr qualitätvolles Portrait in Form einer antiken, vermutlich römischen Bronze aus Volubilis im Archäologischen Museum von Rabat, die von Wolfgang Böhme und Cornelius De Haan publiziert worden ist. Auffallend an dieser Schlangenart "sind zunächst die Augen, die sich unter großen, gewölbten Supraokularregionen befinden"61. Diese `stark akzentuierten Supraokularbereiche´, sind, wie uns Prof. Böhme anhand unserer mitgebrachten Photographien der Laokoongruppe erklärt hat, im Übrigen auch ein kennzeichnendes Merkmal des Kopfes der `unteren´ Schlange (vergleiche hier Dias 19; 20).
Falls sich die rhodischen Künstler im Zusammenhang ihrer Gestaltung der Laokoonschlangen tatsächlich auch mit Europäischen Eidechsennattern beschäftigt haben sollten, muss dies nicht bedeuten, dass ihnen bewußt gewesen ist, dass diese Tiere eine Paar-Bindung haben, noch dass es sich bei diesen Paaren um ein männliches und ein weibliches Tier handelt. Und da der Kopf der `oberen Schlange´ der Laokoongruppe nicht erhalten ist, können wir ebensowenig wissen, ob die rhodischen Künstler ihre beiden Schlangen als ein männliches und ein weibliches Tier gemeint haben; bei vielen Schlangenarten werden ja entweder die männlichen oder die weiblichen Tiere größer. In den im Folgenden diskutierten Rekonstruktionsversuchen der Gruppe sind die daran beteiligten Gelehrten aber offenbar alle stillschweigend davon ausgegangen, dass beide Laokoonschlangen gleich groß gewesen sind (zumindest gleich große Köpfe, sowie Hälse gleich großen Durchmessers besessen haben).
Brunilde Sismondo Ridgway hat darauf hingewiesen, dass in den Fragmenten einer Tragödie des Sophokles, in welcher eine Version der Laokoongeschichte erzählt wird, das Schlangenpaar aus einem männlichen und einem weiblichen Tier besteht, die Porkis und Chariboia heißen62.
Von Brein erfahren wir, dass Augustus eine lebendige indische Riesenschlange in Rom ausgestellt hatte - persönlich folge ich ja jenen Gelehrten, welche die Laokoongruppe für eine originale Schöpfung augusteischer Zeit halten63. Falls diese Datierung der Laokoongruppe korrekt sein sollte, dann scheint auch diese Tatsache zu zeigen, dass es die Künstler der Laokoongruppe, obwohl für sie, zumindest in Rom (falls sie die Laokoongruppe dort geschaffen haben sollten), lebendes Anschauungsmaterial (also zum Beispiel eine Riesenschlange) theoretisch durchaus erreichbar gewesen wäre, doch vorgezogen haben, selbst hybride Schlangenwesen zu entwickeln, welche die Wirkung bei den Betrachtern auslösten, die ihnen selbst vorgeschwebt hat.
Was haben nun unsere `Schlangengespräche´ mit dem Herpetologen
Herrn Prof. Böhme, insgesamt betrachtet, für meine archäologische Erforschung
der Laokoongruppe erbracht? (vergleiche hierzu auch Kapitel IV.2.2., und Anm. 106)
Den Beweis, dass sich die Künstler der Laokoongruppe verschiedene Schlangenarten sehr genau angeschaut hatten, da alle Details der Körper der von ihnen gestalteten Tiere in der Natur so vorkommen - aber an verschiedenen Schlangenarten. Die Laokoonschlangen, mit einer Länge von weit über 4 m, sind somit größer als jede bekannte Giftschlangenart. Da sie jedoch ihre Opfer nicht ersticken (wie es Riesenschlangen, die als einzige Schlangenarten eine vergleichbare Länge aufweisen, tun), müssen wir auf andere Weise ihre Wirkung auf die Protagonisten der Gruppe erklären. Vorausgesetzt es ist richtig, was viele moderne Kommentatoren, meines Erachtens überzeugend, geschrieben haben: Dass nämlich die Künstler den jüngeren Sohn als sterbend gemeint haben, oder, dass er bereits als tot zu verstehen ist, während Laokoon von ihnen als Sterbender charakterisiert wird.
Nach dem soeben Gesagten sieht es meines Erachtens so aus, als hätten die rhodischen Künstler ihre "unwahrscheinlichen Kombinationsschlangen" (so W. BÖHME) für die Laokoongruppe so konzipiert, dass sie, wie Giftschlangen, ihre Opfer durch ihren Biss töten. Andernfalls könnte man sich, bei Betrachtung der Gruppe - nach dem oben Gesagten - das Sterben des jüngeren Sohnes und des Laokoon rational überhaupt nicht erklären.
In Griechenland und Italien sind verschiedene Giftschlangenarten heimisch, diese waren wahrscheinlich den rhodischen Künstler und ihren Zeitgenossen bestens bekannt. Falls die Künstler ihre Schlangen als Giftschlangen gemeint haben sollten, und dies von den zeitgenössischen Betrachtern so verstanden worden ist, muss die Gestaltung der Körper der beiden Tiere, allein schon wegen ihrer enormen Größe - sie sind wesentlich länger als heimische Giftschlangen - eine ungeheure Wirkung auf die Betrachter ausgeübt haben.
Die sehr sorgfältigen Studien für alle Details ihrer Schlangen an verschiedenen, tatsächlich existierenden Schlangenarten, die man den Künstlern der Laokoongruppe somit attestieren muss, beziehen sich - abgesehen davon, dass ihre beiden Schlangen `zu zweit´ jagen, was aber natürlich auch die beiden mythischen Schlangen der verschiedenen Versionen der Laokoongeschichte tun - ausschließlich auf die Gestaltung der Körper ihrer Schlangen.
Was jedoch das Wesen ihrer Geschöpfe betrifft, sowie ihr Verhalten in allen Details, zum Beispiel die `Knoten´, mit welchen die Schlangen ihre Opfer fesseln - was ja so wirkt, als geschehe dies mit ausgesprochen grausamem Vorbedacht - das alles ist von den Künstlers selbst definiert worden.
Diese Ergebnisse unserer oben zusammengefaßten `Schlangengspräche´ mit Herrn Prof. Böhme entsprechen somit in der Summe dem, was - wie wir von Götz Lahusen erfahren - bereits vor ihm viele Gelehrte zum Ausdruck gebracht hatten :
`Bei den Laokoonschlangen handelt es sich schließlich um gottgesandte, mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete, Ungeheuer´.
Eine englische Redensart sagt: `Beauty is in the eye of the beholder´ - horror (`Grauen´64) offensichtlich auch. Das hat nicht erst die Traumfabrik à la Hollywood entdeckt, bereits die Künstler der Laokoongruppe haben dies auf wahrhaft vortreffliche Weise ihren Zeitgenossen - und uns - vor Augen geführt. - Diese Überlegung führt uns zum Kapitel I.1.
I.1. Die beiden Laokoonschlangen beißen den Laokoon und seinen jüngeren Sohn (sein älterer Sohn wird nicht gebissen), und die Gruppe zeigt, wie alle drei Männer darauf reagieren. - Bezüglich der Frage, wo die `obere´ Schlange den Laokoon beißt, gibt es in der Forschung zwei sich gegenseitig ausschließende Meinungen.
Um Ihnen das alles zu demonstrieren, schauen wir uns gemeinsam beide Schlangen von Kopf bis Schwanz an, sowie die komplexe Ergänzungsgeschichte der Gruppe, beginnend mit der Integration des `Pollakschen´ rechten Arms des Laokoon
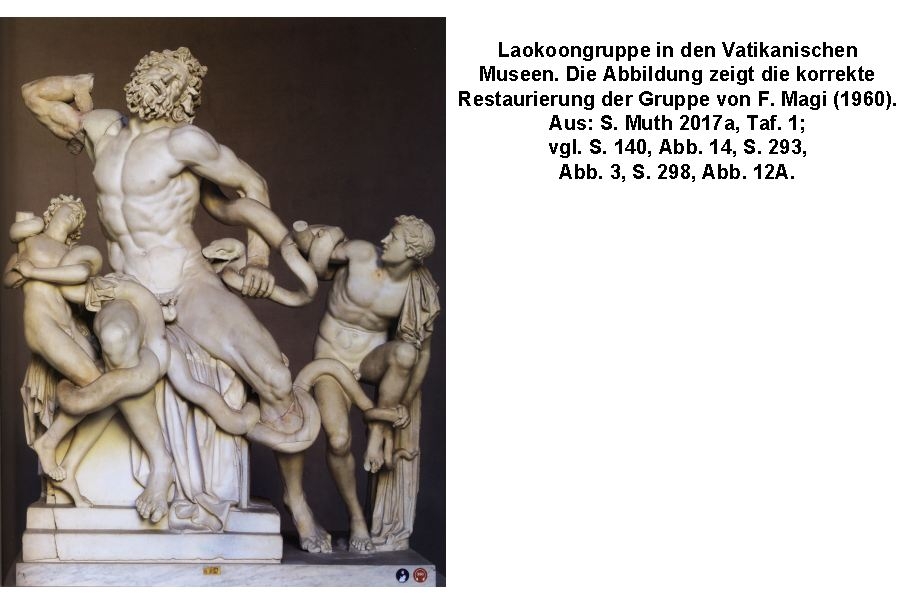
[Vergleiche Dia 6
18. Dia. Photo von Magis korrekter Restaurierung der Laokoongruppe. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 1]
Hier noch einmal die Vorderansicht der Laokoongruppe in der aktuellen Restaurierung von Magi. Wenden wir uns nun, mit diesem Dia 18 `im Hinterkopf´, und Blick auf den vor uns stehenden Gipsabguss, einigen Details der Laokoongruppe zu.
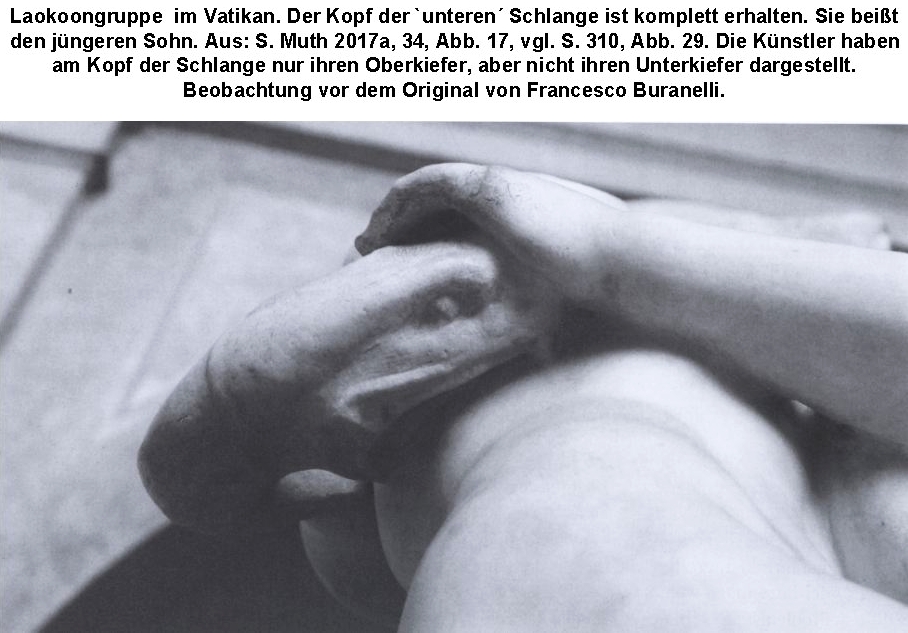
19. Dia. Laokoongruppe im Vatikan. Der Kopf der `unteren´ Schlange ist komplett erhalten. Sie beißt den jüngeren Sohn. Aus: S. Muth 2017a, 34, Abb. 17. Die Künstler haben am Kopf der Schlange nur ihren Oberkiefer, aber nicht ihren Unterkiefer dargestellt. Beobachtung vor dem Original von Francesco Buranelli65.
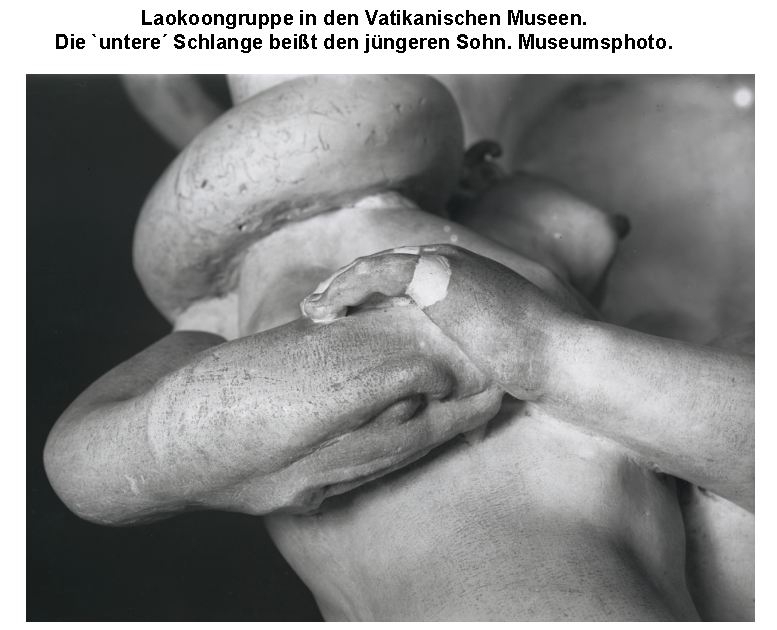
20. Dia. Eine andere Aufnahme vom Biss der `unteren´ Schlange. Museumsphoto.
Beachten Sie bitte, dass Laokoons jüngerer Sohn versucht, mit seiner linken Hand den Kopf der `unteren´ Schlange wegzuschieben. Wir werden später eine ähnliche Reaktion seines Vaters Laokoon auf den Biss durch die `obere´ Schlange sehen.
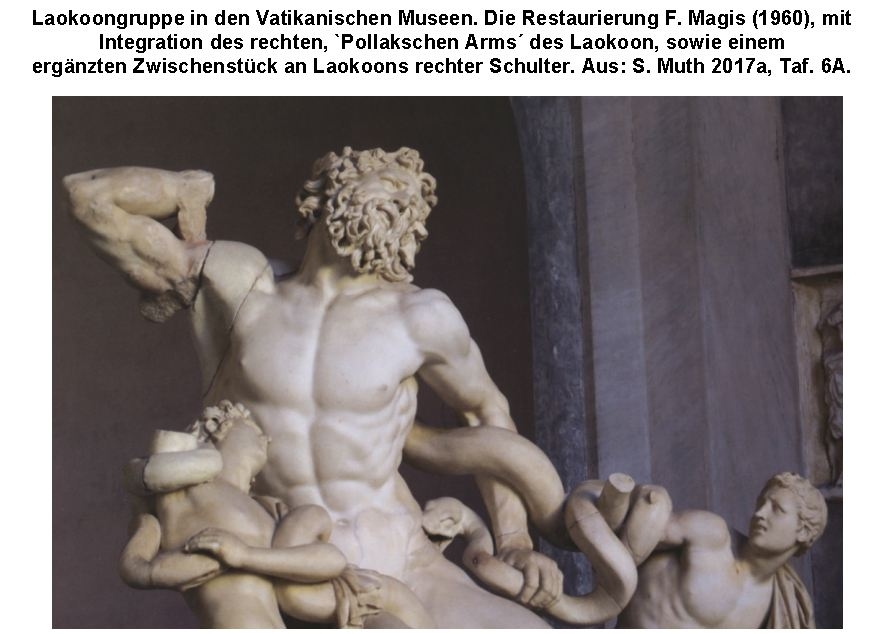
21. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Die Restaurierung F. Magis (1960), mit Integration des rechten, `Pollakschen Arms´ des Laokoon, sowie einem ergänzten Zwischenstück. Aus: S. Muth 2017a, Taf. 6A.
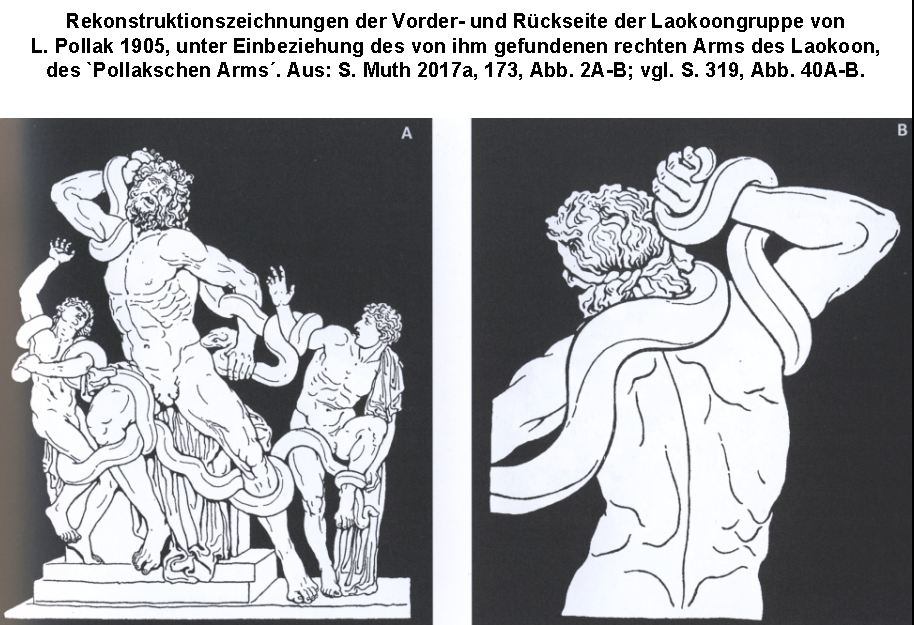
22. Dia: Rekonstruktionszeichnungen der Vorder- und Rückseite der Laokoongruppe von L. Pollak (1905: links: Seite 282, rechts: Seite 280), unter Einbeziehung des von ihm gefundenen rechten Arms des Laokoon, des `Pollakschen Arms66.
Wie bereits auf dem Gemälde Dell'Acquas gesehen (hier Dia 2), war die Laokoongruppe bei ihrer Auffindung nicht komplett erhalten. Nachdem der rechte Arm der Laokoon im Laufe der Zeit mehrfach ergänzt worden war, hat Ludwig Pollak in Rom67 den berühmten `Pollakschen Arm´ entdeckt - das heißt, den rechten Arm des Laokoon. Diesen Marmorarm hat Pollak 1903 gefunden, 1904 den Musei Vaticani geschenkt, und 1905 selbst publiziert. Zu seinen hier auf dem Dia 22 wiedergegebenen Rekonstruktionszeichnungen der Vorder- und Rückseite der Laokoongruppe schrieb Pollak: "Ich liess deshalb auf Grundlage eines Abgusses des Armes und einer Aufnahme des Rückens des Laokoon (diese nach dem Gipse im Lateran) und mit Zuhilfenahme eines lebenden Modells die auf S. 280, 282 reproducirten anspruchslosen Zeichnungen durch den Zeichner Herrn Ernst Sopp herstellen".
Ein im wahrsten Sinne des Wortes sensationeller Fund. Bitte vergegenwärtigen Sie sich einmal, dass die Laokoongruppe zu Pollaks Zeiten annähernd genau so aussah, wie der Gipsabguss, vor dem wir uns hier befinden (dieser Gipsabguß ist auf dem Buchtitel auf Dia 3 wiedergegeben).
Die tatsächliche Tragweite seines, in meinen Augen (womöglich) `bedeutendsten Jahrhundertfunds´ (siehe oben, Anm. 67), war Pollak selbst leider gar nicht klar, da er irrtümlich davon ausging, daß es sich um den Arm des Laokoon einer Kopie der Gruppe im Vatikan handele. Eine Reihe von Gründen für dieses Urteil hat Pollak in seiner diesbezüglichen Publikation selbst genannt: Seiner Ansicht nach unterscheidet sich dieser Arm von der Laokoongruppe, was die verwendete Marmorqualität betrifft, den Größenmaßstab, sowie die Qualität der Bearbeitung.
Von Pollak selbst nicht thematisiert, hing sein Urteil womöglich aber auch damit zusammen, dass der `Pollaksche Arm´ nicht unmittelbar an den noch vorhandenen Rest von Laokoons rechter Schulter anpaßt, so, wie Pollak das Original der Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen gekannt hat - zumindest glaube ich das jener Rekonstruktionszeichnung entnehmen zu können, die unter Pollaks Leitung entstanden ist (siehe hier Dia 22, links). Ich werde darauf unten noch einmal zurückkommen.
Georg Treu, der damalige Direktor des Dresdner Skulpturensammlung, hat im Jahre 1906 die erste Rekonstruktion der Laokoongruppe in Gips ausführen lassen, in welche der `rechte Pollaksche Arm´ des Laokoon integriert worden ist. Treu stand mit Pollak in engem Kontakt und erhielt von diesem einen Gipsabguss des `Pollakschen Arms´. Auch in diese Rekonstruktion wurde der `Pollaksche Arm´ mittels eines Zwischenstücks integriert. "Für die genaue Positionierung des Armfragments [des `Pollakschen Arms´] arbeitete Treu mit einem lebenden Modell", wie Franziska Becker und Simone Vogt schreiben68. Leider ist Treus Gipsrekonstruktion der Laokoongruppe während des Zweiten Weltkriegs zu Grunde gegangen.
Ernesto Vergara Caffarelli (dessen Rekonstruktion wir noch kennenlernen werden, siehe unten, Dia 29) gelang dann der Beweis, dass es sich beim `Pollakschen Arm´ tatsächlich um den rechten, fehlenden Arm des Laokoon handelt, wobei auch Vergara Caffarelli ein `Zwischenstück´ an Laokoons rechter Schulter in seine Gipsrekonstruktion integriert hat69. Schließlich sollte es dann Filippo Magi vergönnt sein, diese Erkenntnisse im Laufe seiner neuerlichen Restaurierung (1957-1960) der Gruppe umzusetzen, indem er dem originalen Laokoon seinen `rechten Pollakschen Arm´ wieder angefügt hat.
Dabei berücksichtigte Magi nicht nur die `zusätzliche Partie´ der rechten Schulter Laokoons, die Francesco Primaticcios Bronzeabguss von 1543 überliefert70 (den wir als nächstes kennenlernen werden). Diese Partie von Laokoons rechter Schulter war als Vorbereitung einer (geplanten) Ergänzung von Laokoons rechtem Armes abgetragen worden. Während der für diese geplante Restaurierung vorgesehene rechte Arm bereits skulptiert worden war und erhalten blieb (der sogenannte bossierte Arm, der ohne ersichtlichen Grund von einigen Gelehrten Michelangelo zugeschrieben wird), ist uns das genaue Datum dieser ganzen Operation leider unbekannt71; das Datum des Bronzeabgusses Primaticcios von 1543 liefert diesbezüglich aber immerhin einen terminus post quem.
Wie Liverani72 schreibt, lagen Magis geglückter Anpassung des `Pollakschen rechten Arms´ an den Laokoon aber auch eigene Überlegungen zur Anatomie des Laokoon zu Grunde. Das wird deutlich, wenn man Magis resultierendes `Zwischenstück´ an Laokoons rechter Schulter73 mit Primaticcios Bronzeabguss der Laokoongruppe74 vergleicht: Magis `Zwischenstück´ ist ja viel breiter geraten als die von Primaticcio überlieferte Schulterpartie Laokoons, die, zeitlich nach Primaticcios Abformung der Laokoongruppe, am Original abgetragen worden ist. Magi hat selbst berichtet, dass der Bildhauer "prof. Antonio Berti" dieses `Zwischenstück´, den "raccordo", wie Magi es selbst nannte, modelliert habe, und dass ihn bei seinen Forschungen zur Anatomie des Laokoon der "chirurgo dott. Gaetano D'Anneo" unterstützt habe75 - mit hervorragendem Erfolg, wie man allen an diesem Unternehmen beteiligten Herren bescheinigen muss.
Den Erkenntnisstand, den Pollak diesbezüglich selbst gehabt hatte, sehen Sie sehr deutlich an der Rekonstruktionszeichnung der Vorderseite der Laokoongruppe, die unter Pollaks Leitung angefertigt worden ist, links im hier gezeigten Dia 22. Pollak hat den Zeichner offensichtlich angewiesen, den von ihm gefundenen `Pollakschen rechten Arm´ des Laokoon unmittelbar an die rechte Schulter Laokoons anzuschliessen, so, wie die Schulter Laokoons zu Pollaks Zeiten erhalten war - weshalb auf der resultierenden Zeichnung der rechte Arm Laokoons viel zu kurz wirkt. Wir werden gleich sehen, warum (vergleiche Dia 23).
Nachdem ich meinen Text bis hierhin verfaßt hatte, konnten Franz Xaver Schütz und ich zum Glück am 28. Februar 2019 im Museo Barracco in Rom die Ausstellung besuchen, die Ludwig Pollak gewidmet worden ist. Im dazu erschienenen Katalog hat Orietta Rossini76 auch über den `Pollakschen Arm´ gehandelt.
Ich zitiere im Folgendem aus ihrem Text, weil dieser eine Reihe von neuen Informationen enthält, die zeigen, wie nahe dem Finder diese ganze Geschichte gegangen war; außerdem zeigen sie, dass Pollak durchaus das Fehlen eines `Zwischenstücks´ an Laokoons rechter Schulter bewusst war. Zu diesen Neuigkeiten zählen auch ganz besonders schöne Nachrichten. Pollak, der zunächst die Enttäuschung erlebt hatte, dass es sich bei `seinem´ Arm nur um eine "Replik" handele, wie er selbst in seinem Tagebuch schrieb, hat noch etwas erlebt, was zuvor unbekannt war: Nicht nur, dass Ernesto Vergara Caffarelli den Beweis dafür erbracht hatte, dass es sich bei dem `Pollakschen Arm´ um den rechten Arm der Laokoonstatue in den Vatikanischen Museen handelt, sondern, dass man seine (Pollaks) Leistung, diesen Arm als den des Laokoon erkannt zu haben, bei dieser Gelegenheit entsprechend gewürdigt hat :
"Il braccio del Laocoonte
Tra gli >>anni d'oro<< vissuti da Pollak , il 1903 rappresenta forse quello più brillante, dato che in quella stessa primavera l'archeologo si rendeva protagonista di un eccezionale ritrovamento, relativo ad uno tra i più famosi gruppi della statuaria greca. Passeggiando sull'Esquilino, nel corso di uno dei suoi consueti soprallluoghi tra scavi, rigattieri, >>marmorari<< e scalpellini, nel laboratorio di uno di questi ultimi, in via delle Sette Sale, Pollak notava ed acquistava un braccio marmoreo ripiegato, che gli veniva detto provenire da scavi effettuati sulla vicina via Labicana (fig. 7["Braccio destro del Laocoonte vaticano in una fotografia fatta eseguire al momento del suo ritrovamento. Museo Barracco. Archivio Pollak, 47.6.4; Hervorhebung von mir]).
Due circostanze, note al Pollak, rendevano grande l'emozione dell'acquisto: il fatto che il luogo era vicinissimo a quello in cui, quattrocento anni prima, era stato ritrovato il gruppo ellenistico del Laocoonte vaticano e la consapevolezza che il braccio destro che allora completava il gruppo era frutto di un restauro cinquecentesco condotto con il gusto dell'epoca. Ma la problematica connessa al braccio ritrovato era complessa. Da una parte, bisognava capire se l'eventuale reintegrazione del gruppo con il braccio ritrovato - in posizione ripiegata e non distesa come nell'integrazione cinquecentesca - fosse filologicamente corretta e restituisse il gruppo alla sua concezione originale; dall'altra, andava accertato se il braccio ritrovato appartenesse proprio all'originale custodito in Vaticano oppure ad una delle molte copie circolanti del gruppo scultoreo.
Pollak meditava a lungo su entrambi i temi e intanto manteneva il riserbo sul ritrovamento, che faceva vedere a pochi, tra i quali Petersen a Bartolomeo Nogara, direttore dei Musei Vaticani. Anche i suoi Diari sono parchi di riferimenti a proposito, almeno fino al marzo del 1904, quando Pollak si recava in Vaticano per donare il ritrovamento e al tempo stesso confrontare da vicino il braccio con il gruppo sistemato nel cortile del Belvedere. L'esame aveva esito dubbi [mit Anm. 22], come scoraggiante risultava un ulteriore confronto effettuato l'anno successivo dal Pollak stesso e dal Nogara. Il fatto era che il braccio ritrovato risultava di circa dieci centimetri più corto di quanto avrebbe dovuto essere l'originale e dunque non combaciava all'attacco con la spalla del Laocoonte [mit Anm. 23].
Si giungeva così al 1906 e alla celebrazione per il quadricentenario del ritrovamento del gruppo vaticano. In quella circostanza Pollak pubblicava Der rechte Arm des Laokoon sui Mitteilungen dell'Istituto Archeologico Germanico [= L. POLLAK 1905] e, nel corso dell'affollato convegno che si teneva nello stesso istituto, interveniva sostenendo, da una parte, la reintegrazione del Laocoonte secondo il tipo del braccio trovato e dall'altra l'appartenenza di quest'ultimo ad una replica del famoso gruppo. Il giorno dopo i quotidiani riportavano a grandi titoli la notizia del ritrovamento e della reintegrazione operata dal Pollak ed in breve l'intera comunità internazionale ne accettava le conclusioni. L'archeologo veniva nominato membro ordinario dell'Istituto Archeologico Germanico e riceveva da Pio X la >>Croce alla Cultura<<, unico ebreo non convertito ad essere in questo modo onorato dal papa.
Solo in seguito, grazie agli studi condotti negli anni Quaranta e Cinquanta dal Vergara Caffarelli e poi dal Magi, l'appartenenza del >>braccio Pollak<< al gruppo Vaticano veniva accertata, e alla fine degli anni Cinquanta si procedeva alla reintegrazione, ricreando il pezzo mancante di raccordo. Ludwig Pollak non aveva la soddisfazione di vedere una delle sculture più famose al mondo ripristinata grazie al suo ritrovamento, ma, contrariamente a quanto finora ritenuto, viveva abbastanza da sapere che il >>suo<< braccio era l'originale braccio destro del Laocoonte: l'archivio Pollak conserva i ritagli di due articoli con annotazioni autografe, comparsi nel '42 su l'Osservatore Romano e sul Corriere della Sera, in cui vengono riferite le conclusioni degli esami condotti dal Vergara Caffarelli e riconosciuto al Pollak il merito della scoperta [mit Anm. 24]". -
Die beiden, von Orietta Rossini erwähnten, Zeitungsausschnitte befinden sich im Archivio Pollak im Museo Barracco. Sie sind mit handschriftlichen Notizen Pollaks versehen und in der Ausstellung `Ludwig Pollak´ 2018-2019 ausgestellt worden, im Katalog (O. ROSSINI 2018a) sind sie aber leider nicht abgebildet.
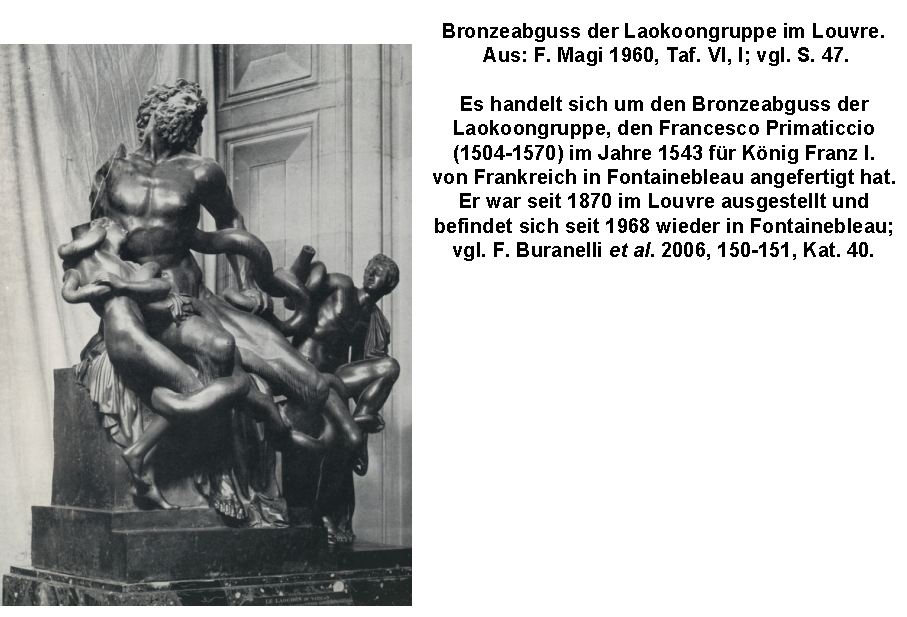
23. Dia. Bronzeabguss der Laokoongruppe im Louvre. Aus: F. Magi 1960, Taf. VI, I; vergleiche S. 47. Es handelt sich um den Bronzeabguss der Laokoongruppe, den Francesco Primaticcio (1504-1570) im Jahre 1543 für König Franz I. von Frankreich in Fontainebleau angefertigt hat. Er war seit 1870 im Louvre ausgestellt und befindet sich seit 1968 wieder in Fontainebleau; vergleiche F. Buranelli et al. 2006, 150-151, Kat. 40.
Einen weiteren bedeutenden Fund hat Filippo Magi77 selbst gemacht. Und zwar im Zusammenhang seiner Untersuchungen dieses Bronzeabgusses im Louvre, den, wie Magi schrieb, Francesco Primaticcio nach einer Abformung des Originals der Laokoongruppe angefertigt hatte: Diese Abformung des Originals war zeitlich der ersten (geplanten) Ergänzung des rechten Arms des Laokoon vorausgegangen war (siehe oben).
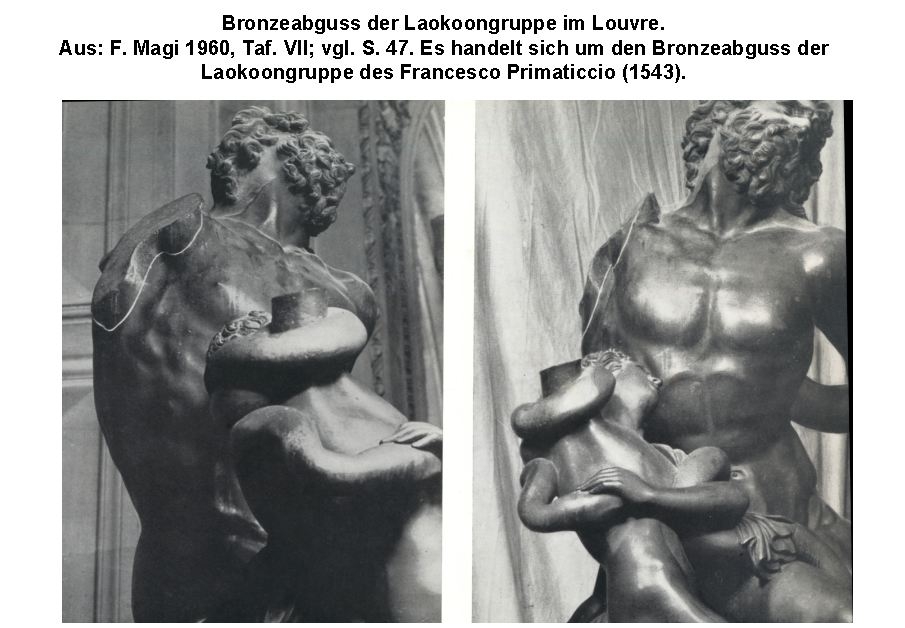
24. Dia. Bronzeabguss der Laokoongruppe im Louvre. Aus: F. Magi 1960, Taf. VII; vergleiche S. 47. Es handelt sich um den Bronzeabguss der Laokoongruppe des Francesco Primaticcio (1543).
Auf dieser Abbildung des Bronzeabgusses der Laokoongruppe des Primaticcio im Louvre hat Magi mit einer weißen Linie markiert, wie viel mehr von der rechten Schulter des Laokoon noch vorhanden war - im Vergleich zum Zustand des Originals der Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen vor Beginn von Magis Restaurierung - von welchem man in der Renaissance, im Zuge der ersten (geplanten) Ergänzung des rechten Armes des Laokoon, diese breite Partie von Laokoons Schulter abgetragen hatte. Magi hat am Original der Gruppe aber nicht nur dieses, von Primaticcio dokumentierte, fehlende `Zwischenstück´ in Marmor ergänzt. Sondern er hat dieses `Zwischenstück´, basierend auf seinen eigenen anatomischen Erkenntnissen zum Laokoon, noch etwas verbreitert.
Auf Grund dieser Operationen ist es Magi schließlich gelungen, an die rechte Schulter des Laokoon - unter Zuhilfenahme seines `Zwischenstücks´ - den `Pollakschen Arm´ anzufügen. Diese Anpassung seines rechten Arms an den Laokoon konnte Magi im Übrigen anhand von technischen Zurichtungen, welche sich an Laokoons rechter Schulter und am `Pollakschen Arm´ erhalten haben, über jeden Zweifel erhaben, beweisen; letztere sind sogar an Primaticcios Bronzeabguss ansatzweise sichtbar78.
Inzwischen ist auch der Marmor der Laokoongruppe getestet worden, wie Paolo Liverani (2006, 31 mit Anm. 25) schreibt, siehe unten, Kapitel IV.2.2.), wobei diese Tests ergeben haben, dass der Laokoon und der `Pollaksche Arm´ aus derselben Qualität parischen Marmors skulptiert worden sind.
Die zuvor gezeigte Rekonstruktionszeichnung aus dem Jahre 1905, die Ludwig Pollak von der Laokoongruppe hat anfertigen lassen (vergleiche Dia 22, links), zeigt den rechten Arm des Laokoon, den Pollak offenbar unmittelbar an Laokoons rechte Schulter hat anpassen lassen, noch ohne Magis breites `Zwischenstück´ an Laokoons rechter Schulter. Auf Pollaks Zeichnung wirkt deshalb Laokoons rechter Arm proportional zu kurz.
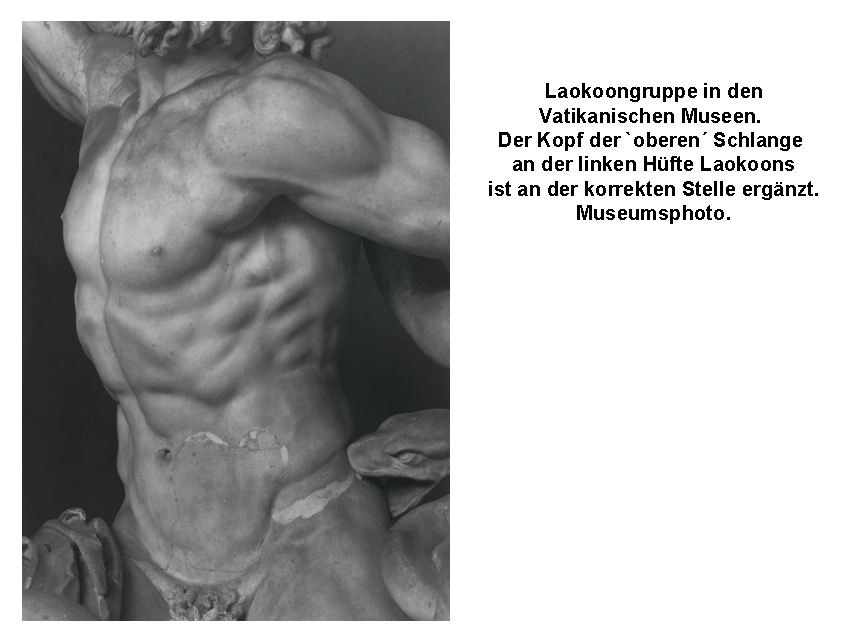
25. Dia. Laokoongruppe in den Vatikanischen Museen. Der Kopf der `oberen´ Schlange an der linken Hüfte Laokoons ist an der korrekten Stelle ergänzt. Museumsphoto.
Wir schauen uns wieder das Original in Magis Restaurierung an. Der Kopf der `oberen´ Schlange ist ergänzt, befindet sich aber an der korrekten Stelle. Nach Liverani79 stammt der ergänzte Kopf der `oberen´ Schlange in Magis hier gezeigter Restaurierung nicht von dem Renaissance-Restaurator der Gruppe, sondern von Agostino Cornacchini.
Wir werden später erfahren, warum sich Magi dazu entschlossen hatte, diese Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange in seiner Restaurierung beizubehalten, anstatt jene - sehr viel genauere - Ergänzung des Kopfes dieser Schlange von Ernesto Vergara Caffarelli (siehe hier Dia 29) zu übernehmen. Genau genommen, hat Magi in seiner Restaurierung der Laokoongruppe Cornacchinis in Marmor ergänzen Kopf der `oberen´ Schlange durch einen Gipsabguss dieser Ergänzung ersetzt80.
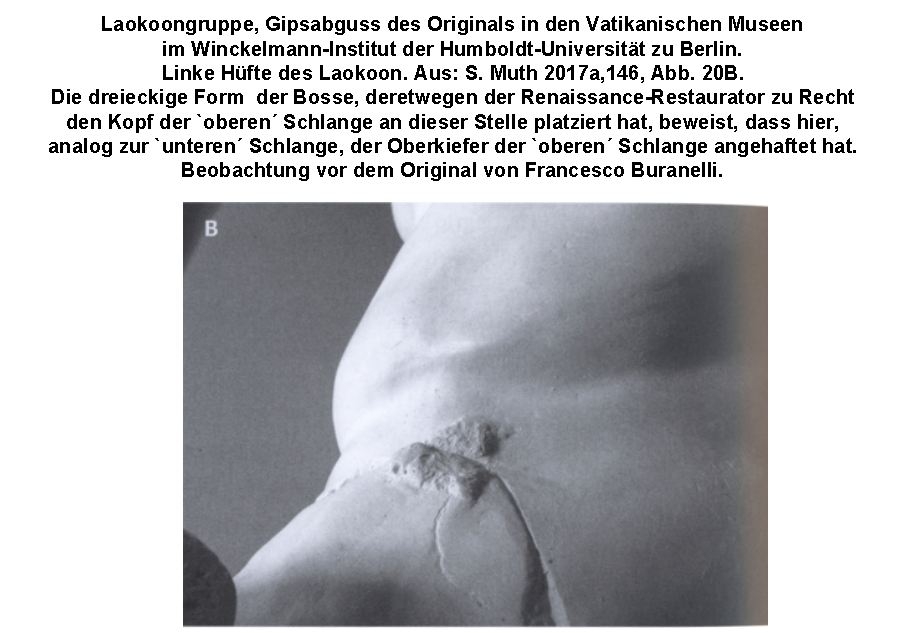
26. Dia. Laokoongruppe, Gipsabguss des Originals in den Vatikanischen Museen im Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Linke Hüfte des Laokoon. Aus: S. Muth 2017a, 146, Abb. 20B.
Wir sehen hier die Bosse an Laokoons linker Hüfte. Die dreieckige Form der Bosse, deretwegen bereits der Renaissance-Restaurator zu Recht den Kopf der `oberen´ Schlange an dieser Stelle platziert hatte, beweist, dass hier, analog zur `unteren´ Schlange, der Oberkiefer der `oberen´ Schlange angehaftet hat.
Diese wichtige Beobachtung hat Francesco Buranelli am 26. April 2018
vor dem Original gemacht
Es ist das große Verdienst des Berliner Projektes von Susanne Muth und ihrem Team, diesen Gipsabguss von den Vatikanischen Museen erworben81, und diese hier gezeigte Aufnahme des Gipsabgusses des Laokoon veröffentlicht zu haben.
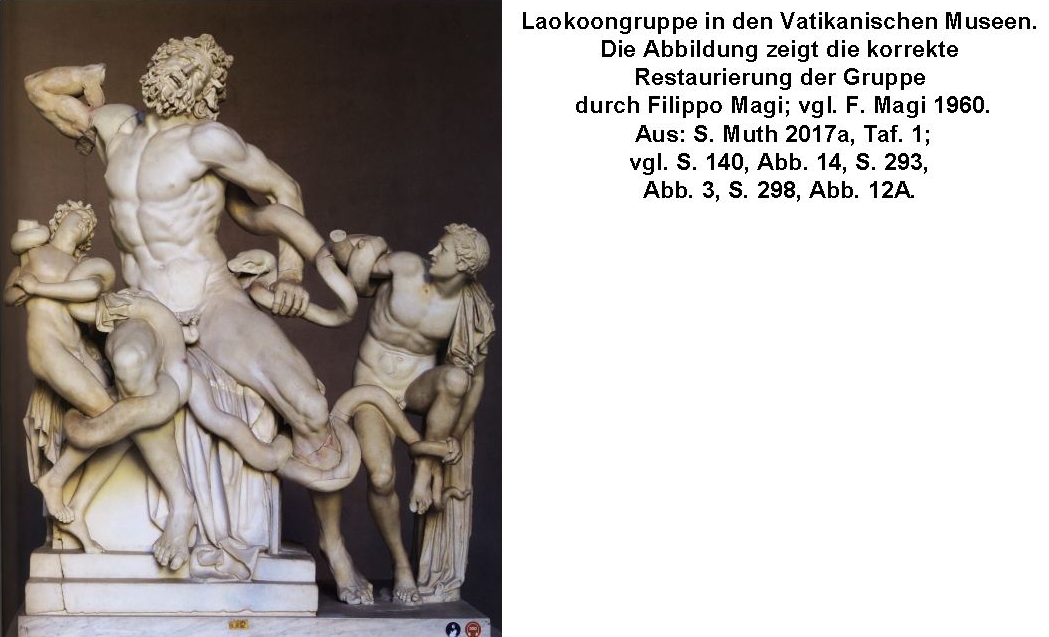
Dia 27.A. [Wiederholung von Dia 6] F. Magis Restaurierung der Laokoongruppe im Vatikan. Aus: S. Muth 2017a, 35, Abb. 18. Die `obere´ Schlange beißt Laokoon in dessen linke Hüfte. Bereits der Renaissance-Restaurator hatte zu Recht den Kopf der Schlange an dieser Stelle angenommen und ihren Kopf, mit dem anhaftenden Hals, ergänzt. Dieser ging später verloren. Sie sehen hier einen Gipsabguss der Ergänzung von Kopf und anhaftendem Teil des Halses der `oberen´ Schlange von Agostino Cornacchini82.

Dia
27.B. Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio, "Ragazzo morso da
un ramarro" (`Junge, von einer Eidechse gebissen´), Öl auf
Leinwand. London, National Gallery.
"Michelangelo Merisi da Caravaggio, Boy bitten by a Lizard, Photo © The National Gallery, London"
CC BY-NC-ND 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/michelangelo-merisi-da-caravaggio-boy-bitten-by-a-lizard (online: 14.9.2025)
Ein zweites Exemplar des Gemäldes befindet sich in Florenz, in der Fondazione
Roberto Longhi (beide 1594/1595); vergleiche für beide Gemälde auch J. Müller (2017, Abb. 1; 2). Im Detail des Gemäldes unten rechts
sieht man die Eidechse.
Hier noch einmal (vergleiche Dia 27.A) das Detail der Laokoongruppe mit dem Biss der `oberen´ Schlange in Laokoons linke Hüfte. Während Laokoons jüngerer Sohn versucht, den Kopf der `unteren´ Schlange mit seiner linken Hand wegzuschieben, versucht Laokoon seinerseits, den Kopf der `oberen´ Schlange von seiner linken Hüfte wegzuziehen, indem er mit seiner hier gezeigten linken Hand eine ihrer Windungen ergreift.
Beide, jüngerer Sohn und Laokoon, werden also nicht nur auf gleiche Weise von den Schlangen gebissen, sie versuchen auch auf analoge Weise, sich dagegen zu wehren. Und zwar versuchen beide noch - wie in einem unbewußten Reflex - die Schlangenköpfe abzuwehren, obwohl beide Schlangen bereits fest zugebissen haben. Während dieses Faktum im Fall des jüngeren Sohnes noch gut sichtbar ist (vergleiche hier Dias 19; 20), traf das, wie wir noch sehen werden, auch im Fall Laokoons zu (darauf werde ich später zurückkommen, siehe unten, zu Dia 39).
Interessant ist eine weitere Parallele von jüngerem Sohn und Laokoon: Beide schauen nicht auf die Schlange, die sie beisst. Eine derartige Reaktion würde mir persönlich naheliegender erscheinen als die Schilderung der Befindlichkeiten der beiden Protagonisten, wozu sich die Künstler entschlossen haben, und die besonders in den, dem Betrachter zugewandten Gesichtern des Laokoon und seines jüngeren Sohnes zum Ausdruck gebracht wird (siehe Anm. 83).
Ich sage das hier, obwohl ich inzwischen von Herrn Prof. Wolfgang Böhme gelernt habe, dass in einer realen Situation das von einer Schlange gebissene Opfer gar keine Zeit mehr dazu hätte, auf die zubeißende Schlange zu blicken (siehe oben, zu Anm. 30).
Apropos das mir unrealistisch erscheinende Faktum, dass in der Laokoongruppe die Künstler die Gesichter des Laokoon und des jüngeren Sohnes dem Betrachter zugewandt haben.
Dass in Caravaggios Gemälde "Ragazzo morso da un ramarro" (`Junge, von einer Eidechse gebissen´; Dia 27.B) dieser Knabe sein schmerzverzerrtes Gesicht dem Betrachter zuwendet, anstatt der ihn beißenden Eidechse, scheint mir daher ein, im Übrigen sehr wirkungsvoller, Kunstgriff zu sein, der meines Erachtens möglicherweise von einem der hier soeben genannten Gestaltungsprinzipien der Laokoongruppe inspiriert worden ist. Wobei mich natürlich auch die seltsam pathetische Präsentation des Knabenkopfes an das Laokoongesicht (hier Dia 8) erinnert hat.
Da mir dieser Einfluß möglich erscheint, und im Übrigen die ursprüngliche farbige Fassung der Laokoongruppe leider nicht mehr erhalten ist (siehe unten, zu Dia 37), bilde ich hier Caravaggios Gemälde `Junge, von einer Eidechse gebissen´ auf Dia 27.B ab, weil Caravaggios Gemälde uns helfen kann, eine Vorstellung von der verlorenen farbigen Fassung der Laokoongruppe zu gewinnen (vergleiche Anm. 83 für die farbige Rekonstruktion der Laokoongruppe in der Berliner Laokoonausstellung).
Theoretisch wäre der hier vorgeschlagene Einfluß der Laokoongruppe auf diese Studie Caravaggios (vergleiche Dia 27.B) möglich, da der Maler das Gemälde 1594-1595 geschaffen hat (in den beiden hier abgebildeten Fassungen), kurz nachdem er in Rom angekommen war.
Caravaggio zeigt auf diesem Gemälde einen Knaben, der offenbar ganz unabsichtlich eine kleine Eidechse gestört hat, die zwischen Blumen versteckt ist, und die sich nun wehrt, indem sie den Knaben in den Mittelfinger seiner rechten Hand beißt. Die erzählte Geschichte ist natürlich nur Vorwand, um eine Ausdrucksstudie zum Thema `Schmerz´ zu gestalten, oder, falls es sich um eine Serie der `5 Sinne´ gehandelt haben sollte, um die Darstellung des `Gefühls´.
In der wissenschaftlichen Diskussion dieses Gemäldes hat man hervorgehoben, dass derartige Themen typisch für die norditalienische Malerei der Zeit waren, gleichzeitig hat man Caravaggios Wahl dieses Sujets als "di stimolo antichizzante dell'ambiente romano" erklärt, wobei sich Mina Gregori im Ausstellungkatalog Caravaggio. La luce nella pittura lombarda (2000, 187) zu beidem äußert.
Andererseits weist Mina Gregori natürlich auch zu Recht darauf hin, dass in der Zeit Stichfolgen beliebt waren, auf denen Darstellungen "dei cinque sensi intrecciati coi quattro elementi" zu sehen waren. Wobei Caravaggio aber offenbar gleichzeitig nicht auch die anderen `Sinne´ und `Elemente´ (wie hier zum Beispiel das `Wasser´ in der Vase, vergleiche Dia 27.B) in einer fünf Gemälde umfassenden Serie geschildert hat.
Dabei gelangt Mina Gregori (2000, 187) insgesamt zu folgendem überzeugenden Schluss: "Si tratta in ogni modo di un ulteriore avanzamento nella rappresentazione delle reazioni psicofisiche, studiate dal pittore [das heißt Caravaggios] in numerose altre occasioni [Hervorhebung von mir]".
Und weil Caravaggio derartige Themen grundsätzlich interessiert haben, kann ich mir lebhaft vorstellen, dass ihn die Laokoongruppe begeistert hat. - Wie wir gleich erfahren werden, kann man das aber auch ganz anders sehen.
Vielleicht hat sich Caravaggio für seine Studie dieses schmerzverzerrten Knabengesichtes (vergleiche Dia 27.B) sogar noch von einer anderen Besonderheit der Protagonisten der Laokoongruppe leiten lassen: auch bei seinem Knaben hat der Biss - in diesem Fall einer kleinen Eidechse - zu einer partiellen Entkleidung seines Protagonisten geführt (der rechten Schulter).
Diese Besonderheit haben wir oben im Zusammenhang der Dias 7-9 bereits an den Protagonisten der Laokoongruppe feststellen können. Wobei der Betrachter wohl mutmaßen soll, dass das in ihrem Fall als eine Folge des bereits erfolgten Kampfes mit den beiden Schlangen zu erklären sei, weshalb wir die drei Männer der Laokoongruppe (hier Dia 18) nun entkleidet vor uns sehen.
In Wirklichkeit haben sich die Künstler der Laokoongruppe aber offenbar deshalb zu dieser Besonderheit ihrer Darstellung entschlossen, um einerseits die Bisse der Schlangen wirkungsvoll präsentieren zu können, und um andererseits die körperliche Schönheit ihrer drei Protagonisten zu feiern.
Im Fall des von Caravaggio portraitierten Knaben kann man dessen Entblößung seiner Schulter nun natürlich nicht `mit einem vorausgegangen Kampf´ mit dieser kleinen Eidechse erklären.
Falls Caravaggio sich für seine Ausdrucksstudie dieses Knaben tatsächlich von der Laokoongruppe (vergleiche Dia 18) inspirieren ließ, dann hat er überdies noch etwas hinzugefügt, was den Protagonisten der Laokoongruppe fehlt: eine unübersehbare erotische Komponente.
Das haben andere Kommentatoren bereits der Eidechse abgelesen, die als Anspielung auf den männlichen Phallus gedeutet werden kann. Ich selbst würde die rechte entblößte Schulter des Knaben in derselben Weise deuten (die an antike Darstellungen der Aphrodite erinnert und an ihr angeglichene Frauen, wie zum Beispiel Bräute, was hier demnach analog gemeint sein könnte; vergleiche Anm. 83), kombiniert mit der weißen Rose hinter seinem rechten Ohr.
Kurzum, es handelt sich bei Caravaggios Darstellung dieses Knaben (vergleiche Dia 27.B), bei dem es sich in Wirklichkeit ja bereits um einen jungen Mann handelt, offensichtlich um ein "object of desire" aus der Perspektive von Homosexuellen - wie der Kunsthistoriker Dirk Kocks in einer Lehrveranstaltung den David des Donatello einmal charakterisiert hat, wobei dieser David ungefähr dasselbe Alter hat wie der Knabe auf Caravaggios Gemälde. - Mit dieser Charakterisierung von Donatellos David hatte Kocks die Beschreibung der Plastik durch Sir Kenneth Clark (1976, 49) paraphrasiert (vergleiche Anm. 83).
Nachdem ich diesen ersten Eindruck zu Caravaggios Gemälde (vergleiche Dia 27.B) notiert hatte, wies mich Franz Xaver Schütz auf den Aufsatz von Jürgen Müller (2017) hin, den dieser Caravaggios Gemälde gewidmet hat.
Müller (2017, 188) ordnet Caravaggios Gemälde (vergleiche Dia 27.B) der Genremalerei zu und, schreibt ebenfalls (Seite 191), dass es sich um eine "Allegorie des Tastsinns bzw. [beziehungsweise] um die Darstellung menschlicher Affekte" handele.
Des Weiteren weist Müller (2017, 197-198 mit Anm. 50, Abb. 7) darauf hin, dass die Laokoongruppe bereits von Maurizio Calvesi (1990, 393-394) als Vorbild für Caravaggios Gemälde (vergleiche Dia 27.B) angesehen worden sei. Vergleiche S. 198: "... der [Calvesi] allerdings einen Vergleich zum Motiv des kämpfenden Vaters sieht [mit Anm. 50]. In Wirklichkeit spielt der Künstler [Caravaggio, vergleiche hier Dia 27.B] auf den älteren Sohn auf der rechten Seite an, den die Schlange gefesselt hat [vergleiche hier Dia 18] und der in banger Erwartung dem grausigen Geschehen zuschauen muss [Hervorhebung von mir]".
Wobei also Calvesi (1990, 393-394), genau wie ich, den Knaben auf Caravaggios Gemälde mit dem Laokoon verglichen hat. Müller selbst lehnt diesen Vergleich mit dem Laokoon als angeblich irrelevant ab und kann seinerseits zeigen, dass einige Kompositionslinien in der Bekleidung von Caravaggios Knaben ohne das Vorbild des älteren Sohnes des Laokoon ganz undenkbar wären. - Ich selbst bleibe nach dem oben Gesagten der Auffassung, dass Caravaggio von allen drei Protagonisten der Laokoongruppe: das heißt, vom Vater und von beiden Söhnen, Anleihen für die Gestaltung seines Knaben (vergleiche Dia 27.B) gemacht hat.
Müller (2017, 185) zeigt, dass es sich bei dem auf Caravaggios Gemälde (vergleiche Dia 27.B) portraitierten Knaben um "eine `bardassa´, einen Homosexuellen, dem die weibliche Rolle zufällt" handele, und folgert überzeugend (S. 199), dass sich das Gemälde an Betrachter/ potentielle Auftraggeber für weitere Arbeiten wandte, die sich, wie Caravaggio selbst, persönlich für Knabenliebe interessierten.
Im Übrigen analysiert Müller nicht nur Caravaggios ikonographische Anleihen für dieses Gemälde an der Laokoongruppe, sondern auch die an zahlreichen anderen, hauptsächlich christlichen Ikonographien. Hierbei handelt es sich bezeichnenderweise ausschließlich um Darstellungen von Frauen, wobei Müller (2017, 194, Abb. 4-6) die Entblößung der rechten Schulter des Knaben überzeugend auf venezianische Gemälde von Kurtisanen zurückführt, auch deren typische Handhaltungen übernimmt Caravaggio für seinen Knaben.
Besonders interessant ist, dass Müller (2017, 200 mit Anm. 54, Abb. 9, 10) nachweisen kann, dass Caravaggio für diesen Knaben (hier Dia 27.B) Anleihen bei der Verkündigungsikonographie Mariens gemacht hat. Und zwar handelt es sich um dasselbe Motiv der Hände, das bereits für jene oben erwähnten venezianischen Kurtisanengemälde Verwendung gefunden hatte, und das, analog zu Maria in der Verkündigungsszene, auch bei diesen Kurtisanen und bei Carvaggios Knaben (in diesen Fällen allerdings vorgebliche) Keuschheit signalisieren sollte:
"Die vor Schreck emporgerissene sowie die mit den Fingern nach unten weisende Hand ... Caravaggio orientiert sich für die exaltierten Gesten seines Jünglings (vergleiche aber Anm. 83) am Motiv der Conturbatio Mariens". Wobei, wie Müller (2017, 200) des Weiteren erklärt, gerade das Signalement von Keuschkeit bei Frauen von den zeitgenössischen Männern als äußerst anziehend empfunden worden sei, sogar im Fall von Kurtisanen (was offenbar auch für den von Caravaggio gemalten Knaben, hier Dia 27.B, galt).
Auch Müllers (2017) Analyse vieler Details des Gemäldes (vergleiche Dia 27.B) zeigt also, dass meine oben vorgeschlagene homoerotische Deutung des Gemäldes korrekt ist (vergleiche J. MÜLLER 2017, 194, 196, zum Hinweis der Eidechse auf das männliche Geschlecht und auf den homosexuellen Gechlechtsakt). Dabei bringe der Verweis auf die Kurtisanenbilder zum Ausdruck, dass es sich um `käufliche Liebe´, und somit bei dem Knaben um einen Prostituierten handele.
Im Unterschied zu dem, was mir selbst aufgefallen war, ist Müller (2017, 204, 210) davon überzeugt, dass die Zitate der Laokoongruppe in diesem Gemälde (vergleiche Dia 27.B) so zu interpretieren seien, dass Caravaggio sich über die Laokoongruppe lustig mache, und dass das Ganze als Satire gemeint sei.
Wenn Caravaggio diesen Knaben (vergleiche Dia 27.B), und noch dazu einen Prostituierten, tatsächlich mit Anspielungen an die Verkündigungsikonographie Mariens dargestellt hat - wie es den Anschein hat - ist Müllers Vorschlag, das Ganze sei von dem Maler als Satire gemeint gewesen, sehr ernst zu nehmen. Ansonsten hätte sich Caravaggio womöglich der Gefahr ausgesetzt, von seinen Zeitgenossen der Blasphemie bezichtigt zu werden. - Mit manchen von ihnen, vor allem mit Kollegen, hat sich Caravaggio ja bekanntlich ohnehin schon heftig gestritten, wobei Müller (2017) über ein besonders krasses Beispiel berichtet.
Der hier gezogene Vergleich der Entblößung der rechten Schulter des Knaben auf Caravaggios Gemälde mit den Protagonisten der Laokoongruppe führt uns nun wieder zurück zu der Gruppe.
Die Konzeption des Cortile delle Statue, wo die Laokoongruppe aufgestellt worden ist
"Procul este prophani [state lontani, o profani]"
Giandomenico Spinola (2021, 123).
Spinola (2021, 123) beschreibt die geistige Konzeption des Cortile delle Statue (heute in den Vatikanischen Museen) wie folgt:
"Il valore propagandistico del Cortile delle Statue era diretto alle classi più elevate e colte, che comprendevano anche i governanti e le delegazioni degli Stati laici, con cui si voleva aprire un dialogo basandosi su un elemento comune, la cultura. Lì ci si poteva incontrare e conversare, ammirando le antichità, e sul portale d'ingresso fu posta un'iscrizione, tratta non a caso da un verso virgiliano dell'Eneide (VI, 258), che idealmente scoraggiava l'accesso ai non adepti: ``Procul este prophani´´ [state lontani, o profani] [Hervorhebung von mir]".
Vergleiche Vergil (Aeneis VI. 258): Procul, o procul este profani (Bleibt fern, Unheilige, fliehet!).
Online at: https://www.gottwein.de/Lat/verg/aen06la.php [18-XII-2021].
Dieses Motto habe ich diesem Unterkapitel erst voranstellen können, nachdem das hier Folgende bereits geschrieben war. Ich muss aber gestehen, dass ich diese Inschrift auf dem Eingangsportal des Cortile delle Statue mit dem Vergilzitat bislang übersehen habe (!). Im Zusammenhang meiner Diskussion dieser Inschrift mit Giandomenico Spinola hat er mich am 20. Dezember 2021 auf seine ausführlichere Schilderung der antiken Statuen im Cortile delle Statue aufmerksam gemacht. Dieser Aufsatz Spinolas ist eine meisterhafte Schilderung dieser berühmten Statuensammlung seit ihrer Gründung bis zur Schaffung des Museo Clementino, in der er die tatsächliche Bedeutung der dort präsentierten Skulpturen, aber auch ihre damalige Deutung innerhalb dieses Ensembles aufzeigt ("Il cortile delle Statue e il dialogo con l'Antichità", 2012).
Wie bereits gesagt, gebe ich auch gerne zu, dass es den Künstlern hervorragend gelungen ist, bei Betrachtern der Laokoongruppe (wenigstens zumeist) die intendierten Reaktionen hervorzurufen: Und zwar mit ihrer elegischen Schilderung des jüngeren Sohnes, der nach Ansicht mancher Gelehrter als sterbend, oder als bereits gestorben zu denken ist, und dem dramatischen Sterben Laokoons83.
Bei mir hat sich diese Wirkung bei der ersten Begegnung mit der Laokoongruppe dagegen nicht einstellen wollen. Und das, obwohl ich zur Vorbereitung einige der bekannten Texte der deutschen Klassik zum Thema gelesen84, und fest mit einem entsprechend erschütternden Erlebnis gerechnet hatte. Das war im September 1972, mit den Dozenten und Studenten des Kunstseminars Duisburg.
Kurt Sandweg85, bei dem ich Bildhauerei studierte, und ich standen plötzlich gemeinsam vor dem Original und er fragte mich nach meinem ersten Eindruck. "Mich überzeugt das gar nicht", habe ich geantwortet, "die Gruppe sieht doch bloß so aus wie ein mittelalterlicher Totentanz" - was mir einen großen Tadel meines Lehrers eingehandelt hat.
Heute weiß ich den Grund meiner Enttäuschung (was nun zusätzlich noch durch das oben wiedergegebene Zitat aus G. SPINOLA 2021, 123, betätigt wird).
Die Laokoongruppe muss nicht nur durch entsprechende Beleuchtung inszeniert werden86, sie `braucht´ auch ein räumlich - und vor allem akustisch - kontrolliertes Umfeld, um überhaupt in der intendierten Weise wirken zu können. Wie zum Beispiel bei der Betrachtung von Photographien - `bei der wir ganz allein sein können mit der Gruppe´. Damals ging es mir so, wie später bei Freunden in Rom, mit denen ich Kriminalfilme im privaten Fernsehen angeschaut habe, die durch Werbespots unterbrochen wurden.
Was ich nie für möglich gehalten hätte: Wegen dieser ständigen Unterbrechungen durch Werbespots machte es mir plötzlich nichts mehr aus, die spannendsten Krimis anzusehen.
Ähnlich war es beim ersten Kennenlernen der Laokoongruppe. Anstatt mittels einer stillen, oder gar weihevollen Atmosphäre eingestimmt zu werden - was ich wohl insgeheim erwartet hatte - umgaben mich im Cortile del Belvedere (wie er damals hieß), rund um die Laokoongruppe, unübersehbare Massen von fröhlich miteinander schwatzenden Touristen.
Die haben sich für alles mögliche interessiert, wie man ihren lauten Gesprächen entnehmen konnte, nur nicht für das vor ihren Augen inszenierte tragische Schicksal des Laokoon und seiner Kinder.
Dieses touristische `Happening´87 hat mich daran gehindert, mich gefühlsmäßig auf die Skulptur wirklich einlassen zu können.
[Bitte drehen Sie den Gipsabguss der Laokoongruppe jetzt herum, damit wir seine Rückseite anschauen können.]
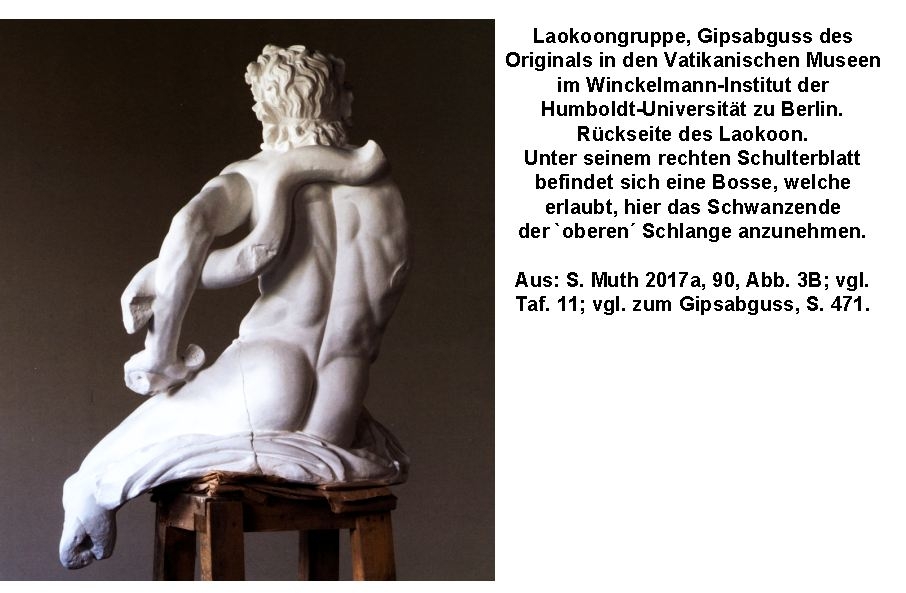
28. Dia. Laokoongruppe, Gipsabguss des Originals in den Vatikanischen Museen im Winckelmann-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Rückseite des Laokoon.
Unter seinem rechten Schulterblatt befindet sich eine Bosse, welche erlaubt, hier das Schwanzende der `oberen´ Schlange anzunehmen. Aus: S. Muth 2017a, 90, Abb. 3B; vergleiche Taf. 11; vergleiche zum Gipsabguss, S. 471.
Das Schwanzende der `oberen´ Schlange berührte den Rücken des Laokoon unter seinem rechten Schulterblatt. Das kann man sich auf Grund einer entsprechenden Bosse vorstellen, die sich an dieser Stelle befindet; in der Vergangenheit sind mehrere Rekonstruktionen in Gips erstellt worden, welche diesen Gedanken umgesetzt haben. Diese Bosse sieht man auch auf dem Berliner Gipsabguss des Laokoon88.
Am Original in den Vatikanischen Museen ist auf dem Rücken des Laokoon im oberen Bereich ein Teil der `oberen´ Schlange erhalten, der sich schlängelnd von links nach rechts bewegt, und der ebenfalls, analog zu den beiden Schlangenkörpern auf der Vorderseite der Gruppe, in sehr hohem Relief, und in voller Länge (!), dem Rücken Laokoons aufgelegt ist.
Vor dem Original habe ich bestätigt gefunden, daß sich dieser Schlangenteil auf dem Rücken Laokoons von links (unten) nach rechts (oben) gesehen verjüngt89.
Der Kopf der `oberen´ Schlange befand sich also folglich links, nicht rechts, wenn man die Gruppe von hinten betrachtet.
Um diesen Befund beurteilen zu können, müssen wir den Körperbau der Laokoonschlangen berücksichtigen.
Wenn wir davon ausgehen, dass beide Schlangen gleichartig gestaltet waren, was bislang alle modernen Kommentatoren stillschweigend voraussetzen, dann sind wir in der glücklichen Lage, ihren Körperbau beschreiben zu können, da die `untere´ Schlange nahezu vollständig erhalten ist.
Unmittelbar hinter ihrem Kopf weist die `untere´ Schlange eine leichte Einschnürung ihres Körpers auf, hierbei handelt es sich also um den Hals der Schlange (vergleiche hier Dias 19; 20).
Nach dieser kurzen Halspartie nimmt der Umfang ihres Leibes sehr schnell zu (vergleiche für das Folgende Dias 5; 6; 18; 22, links; 29, links; 31; 33, links; 34, links; 39), um dann von dem einmal erreichten Punkt des höchsten Körperumfangs an in Richtung zum Schwanz wieder abzunehmen.
Es fällt auf, dass die `untere´ Schlange einen vergleichsweise sehr langen, dünnen Schwanzteil besitzt. Diese deutliche Verringerung ihres Leibesumfangs beginnt, wenn man die Vorderseite der Gruppe betrachtet, bereits auf der Mitte des rechten Oberschenkels des älteren Sohnes.
Dieser Schwanzteil der `unteren´ Schlange beginnt an diesem Punkt und reicht bis zum linken Knöchel des älteren Sohns, um den die Schlange eine Windung legt, und endet in der noch wesentlich dünner ausgebildeten Schwanzspitze.
Die Schwanzspitze der `unteren´ Schlange liegt dem Gewand des älteren Sohnes auf, das in der Vorderansicht der Gruppe neben ihm von seiner linken Schulter herab kaskadenartig bis auf die Plinthe fällt.
Wenn man die Erkenntnis berücksichtigt, dass sich der Körper der `unteren´ Schlange demnach (abgesehen von ihrer insgesamt sehr kurzen Halspartie) nur in einer Richtung, und zwar vom Kopf zum Schwanz hin, verjüngt, und dass im Fall der `unteren´ Schlange der Schwanzteil ungewöhnlich lang und dünn ausgefallen ist, dann haben wir somit ein weiteres Argument für die Annahme gefunden, daß der Kopf der `oberen´ Schlange vom Renaissance-Restaurator, der ihren Kopf an Laokoons linker Hüfte angenommen hatte, richtig platziert worden ist.
Im Übrigen wird die hier soeben gemachte Behauptung - dass sich die `obere´ Schlange auf dem Rücken Laokoons von links (unten) nach rechts (oben) verjüngt - dadurch bestätigt, dass sich die `obere´ Schlange auch um den `rechten Pollakschen Arm´ Laokoons windet.
Jener Teil der `oberen´ Schlange, der um den `Pollakschen Arm´ gelegt ist, hat, wenn man die Rückseite der Gruppe betrachtet, einen noch wesentlich geringeren Durchmesser (vergleiche hier Dia 22, rechts; Dia 32)90 als jener Teil derselben Schlange, der auf dem Rücken des Laokoon ganz rechts oben liegt.
Diese eben erwähnten Fakten haben Luca Giuliani und Susanne Muth dokumentiert, indem sie die Durchmesser der `oberen´ Schlange auf dem Rücken Laokoons an zwei Stellen gemessen haben.
In der Mitte von Laokoons Rücken: 9,4 cm, ganz oben rechts: 7,2-7,8 cm. Außerdem haben sie zwei Durchmesser der `oberen´ Schlange am rechten `Pollakschen Arm´ auf dessen Rückseite gemessen: 6,4 und 6,0 cm91.
Wichtig ist, dass das Segment der `oberen´ Schlange, das dem Rücken Laokoons anhaftet, und die Windung der `oberen´ Schlange um den `Pollakschen Arm´ auf der Rückseite der Gruppe, nicht neuzeitlich verändert wurden, und daher die hier aufgestellte Behauptung stützen können.
Giuliani und Muth erwähnen ja zu Recht, dass das Segment der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, neuzeitlich überarbeitet worden ist.
Giuliani und Muth zitieren Magi (siehe unten, Anm. 92), der diese Entdeckung als erster gemacht und publiziert hat, und bilden auch seine Tafel ab, welche diesen Befund dokumentiert, beschreiben jedoch Magis diesbezügliche Erkenntnisse fehlerhaft, und nicht in ihrer Gänze.
Magi hatte nämlich diesen Befund, oder genauer gesagt, die von ihm an dieser Stelle beobachteten verschiedenen Befunde, ganz anders als sie selbst gedeutet.
Wobei in meinen Augen Magi diese Spuren überzeugend interpretiert hat:
Magi beschreibt an dieser Stelle die beiden "tagli di connessione" (`auf Anpassung an Gegenstücke gearbeitete Ansatzflächen´) jenes Teilstücks der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand umschließt.
Wie Magi ausdrücklich sagt, ist das Volumen des Körpers der `oberen´ Schlange an dieser Stelle bereits in der Antike verringert worden; im hier betrachteten Fall handelt es sich um die Partie unmittelbar anschießend an jene Ansatzfläche des Teilstück der `oberen´ Schlange, die unter linker Laokoons Hand ganz rechts verborgen ist, wenn man die Gruppe von vorn betrachtet.
Das ursprünglich an diese Ansatzfläche angepaßte, jetzt jedoch verlorene, Gegenstück der `oberen´ Schlange hatte rechts aus Laokoons Faust herausgeschaut, wenn man die Gruppe von vorn betrachtet (vergleiche hier Dias 27.A; 28; 30).
Auf Aufnahmen, die Laokoons linke Hand von hinten zeigen (siehe unten, Anm. 92), ist diese hier beschriebene Ansatzfläche, die unter Laokoons linker Hand verborgen ist, gut sichtbar.
Wenn man hinter dem Original der Laokoongruppe steht, sieht man Folgendes: Laokoon umschließt mit seiner linken Faust das hier beschriebene Teilstück der `oberen´ Schlange. Nach links, zum älteren Sohn hin, setzt sich dieser Teil des Schlangenleibes (der neuzeitlich ergänzt ist) fort.
Diese neuzeitliche Ergänzung der `oberen´ Schlange reicht offenbar bis zu der antiken Ansatzfläche, die Magi beschrieben hat, und die, wegen der Ergänzung des Ansatzstückes, jetzt verborgen ist92.
Genau an dieser Stelle waren hier am Original ursprünglich zwei skulptierte Teile der Gruppe zusammengetroffen, wie man sowohl auf Magis Abbildungen, als auch auf denen im Begleitband zur Berliner Ausstellung von 2016-2018 erkennen kann: Der Laokoonblock und der Block mit dem älteren Sohn. Bedingt durch die Tatsache, dass das Original der Laokoongruppe nicht mehr komplett erhalten ist, treffen nun an dieser Stelle theoretisch sogar drei separat skulptierte antike Blöcke zusammen, nicht nur Laokoon und der ältere Sohn, sondern auch noch ein separat skulptiertes Schlangenstück, welches die beiden ursprünglichen Blöcke miteinander verbindet.
Nach der Nomenklatur der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe handelt es sich um den Block A: Laokoon, sowie um den Block C & G: Älterer Sohn (C) und Schlangengewinde am rechten Arm des älteren Sohnes (G); wobei Block G, das am rechten Arm des älteren Sohnes anhaftende Schlangengewinde, ursprünglich zu Block C dazugehört hatte. In Wirklichkeit verbindet Block G die beiden Blöcke A und C aber gar nicht mehr miteinander: Block G ist nämlich leider nicht mehr komplett, es fehlt jenes Teilstück der Windung der `oberen´ Schlange, welches unmittelbar an jenes angepaßt hatte, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift (siehe unten, Anm. 92).
Als die drei rhodischen Künstler die Endmontage der Gruppe durchführen wollten, hatte sich dann offenbar herausgestellt - so überzeugend Magi (siehe oben, Anm. 192) - dass die beiden, rechts von Laokoons Faust aneinanderstoßenden Teile der `oberen´ Schlange, also auf Block A und Block C, später G (wenn man die Gruppe von vorn betrachtet; vergleiche Dia 27.A), zunächst unterschiedliche Durchmesser aufgewiesen hatten. Deshalb musste der Durchmesser des hier betrachteten Segments der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit der linken Hand ergreift (das heißt, auf Block A), entsprechend verringert werden, damit er an das anschließende Teil des Körpers der `oberen´ Schlange auf Block C/G anpaßte.
Da man diese `Nahtstelle´ der beiden Teilstücke der `oberen´ Schlange nur von der Rückseite der Laokoongruppe einsehen konnte, beweist diese von den rhodischen Künstlern vorgenommene Korrektur nicht nur - einmal mehr - die hohe Qualität ihrer Arbeit, aber natürlich auch - einmal mehr - dass die Laokoongruppe von allen Seiten sichtbar sein sollte.
Des Weiteren hatte Magi, anläßlich seiner Diskussion der beiden Ansatzflächen jenes Segments der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, auch verschiedene Spuren von neuzeitlichen Bearbeitungen beschrieben - wie von Giuliani und Muth angemerkt. Diese Spuren befinden sich aber - wie Magi ausdrücklich schreibt - auf der anderen Seite dieses Teilstücks der `oberen´ Schlange, nämlich links von Laokoons Faust, wenn man die Gruppe von vorn betrachtet (vergleiche hier Dia 27). Vor seiner Diskussion dieser beiden Ansatzflächen des Teilstücks der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, sowie unmittelbar anschließend, hatte Magi weitere moderne Eingriffe im Bereich von Laokoons linker Hand beschrieben. Hierbei handelte es sich um Reparaturen, die notwendig geworden waren, weil der Block mit dem Laokoon, im Zuge des Rücktransportes der Gruppe aus Paris, am 23. November 1815, bei einem Sturz auf dem Moncenisio, beschädigt worden war. Bei diesem Sturz war zum Beispiel Laokoons linke Hand in der Handwurzel abgebrochen, die dann wieder angesetzt worden sei.
Als Ganzes betrachtet, ist somit die Argumentation von Giuliani und Muth irreführend, da die Autoren verschweigen, dass Magi nicht nur Spuren von neuzeitlichen Überarbeitungen im Bereich von Laokoons linker Hand beobachtet hatte, sondern zusätzlich die wesentlich bedeutenderen antiken Überarbeitungen, welche Giuliani und Muth nun dagegen als Eingriffe der Renaissance deklarieren.
Wichtig ist, dass Giuliani und Muth auf diese Weise auf Magis bedeutende Beobachtung hingewiesen haben, derzufolge an dieser Stelle das Volumen des Körpers der `oberen´ Schlange verringert worden ist. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Korrektur, welche bereits die Künstler des Originals bei der Montage der einzelnen Teile der Gruppe vorgenommen hatten, wie Magi ausdrücklich geschrieben hat (siehe oben, Anm. 92), nicht erst um eine diesbezügliche Überarbeitungen der Renaissance. Weshalb dieser Befund keineswegs als Hinweis darauf gewertet werden darf, dass im Zuge der Ergänzung der Gruppe in der Renaissance das Volumen des Schlangenkörpers an dieser Stelle verringert worden sei, angeblich deshalb, um die geplante Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange an Laokoons linker Hüfte zu begründen.
Diese Hypothese vertreten jedoch Giuliani und Muth, welche alle oben genannten Beobachtungen an den Laokoonschlangen gegenteilig zu der hier vorgetragenen Hypothese interpretieren, worauf ich unten, im Kapitel II. zurückkommen werde.
Die Windung der `oberen´ Schlange um den `rechten Pollakschen Unterarm´ des Laokoon ist vollplastisch nur auf der Rückseite Laokoons erhalten. Auch auf seiner Vorderseite kann man den Verlauf dieser Schlangenwindung deutlich erkennen, und zwar deshalb, weil die `obere´ Schlange dem rechten Arm des Laokoon in ganzer Länge dieser komplexen Schlangenwindung angehaftet hatte (vergleiche hier Dias 6; 18; 21, 22, rechts; 29, rechts; 32).
In der neuen Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe ist das Teilstück der `oberen´ Schlange, das sich um Laokoons rechten Arm windet, auch auf der Vorderseite rekonstruiert worden; sein Durchmesser ist jedoch korrekterweise nur an dem antiken Teil der `oberen´ Schlange gemessen worden, der sich auf Laokoons Rückseite befindet. Wie oben bereits mitgeteilt, haben Giuliani und Muth die Durchmesser der entsprechenden Windung der `oberen´ Schlange um Laokoons rechten Oberarm an zwei Stellen auf der Rückseite gemessen: Er beträgt 6,4 cm, beziehungsweise 6,0 cm93.
Insgesamt betrachtet, macht die `obere´ Schlange um den `rechten Pollakschen Ober- und Unterarm´ des Laokoon einen "S"-förmigen Knoten. Nach dem Augenschein zu urteilen, besitzt die Windung der `oberen´ Schlange um den Unterarm Laokoons (auf der Rückseite der Gruppe) den gleichen Durchmesser wie der Schwanzteil der `unteren´ Schlange (auf der Vorderseite der Gruppe), der als Knoten um den linken Knöchel des älteren Sohnes gelegt ist (siehe hier Dias 5; 6; 22, links; 29, links; 31; 33, links; 34, links).
Dies ist tatsächlich der Fall, denn im Zuge des Berliner Projektes sind an der computergenerierten Rekonstruktion der Laokoongruppe auch die Durchmesser der hier genannten Teilstücke beider Schlangen gemessen worden. Meiner Meinung nach bestätigen diese erhobenen Maße meine soeben gemachte Behauptung. Für die Maße der `oberen´ Schlange, siehe oben, auf die entsprechenden Maße der `unteren´ Schlange werde ich unten noch einmal zurückkommen.
Ich halte dieses Faktum für ein Indiz, welches die hier vorgetragene Annahme stützt, dass der eben beschriebene, von der `oberen´ Schlange "S"-förmig um den `Pollakschen Ober- Unterarm´ des Laokoon gelegte Doppel-Knoten zum Schwanzteil dieser Schlange gehört. Folglich fiel das Schwanzende der `oberen´ Schlange auf den Rücken Laokoons herab, und die Schwanzspitze der `oberen´ Schlange berührte, wie oben bereits behauptet, den Rücken Laokoons unter dessen rechtem Schulterblatt an der Stelle jener Bosse, die wir auf dem hier gezeigten Dia 28 sehen. Wie wir unten, in Kapitel II. sehen werden, sind die Autoren des Berliner Projekts bezüglich dieser Bosse auf Laokoon Rücken dagegen zu einer ganz anderen Auffassung gelangt.
Nun also zu den bereits angekündigten Maßen der Durchmesser der `unteren´ Schlange
Im Zuge des Berliner Projektes sind an der computergenerierten Rekonstruktion der Laokoongruppe auch die Durchmesser der hier genannten Teilstücke der `unteren´ Schlange gemessen worden, und zwar auf der Vorderseite der Gruppe. Nota bene: Die Maße sind zwar an der Computerrekonstruktion der Laokoongruppe genommen worden, aber nur an Stellen, die am Original erhalten sind. Zwei Durchmesser der `unteren´ Schlange sind an deren Hals gemessen worden: 5,4 cm (unmittelbar hinter dem Kopf der Schlange), die zweite Messung hat einen Durchmesser von 5,0 cm ergeben; dieser Teil der `unteren´ Schlange befindet sich dort, wo die `untere´ Schlange den Körper des jüngeren Sohnes von hinten kommend umfängt - eine Partie, die gerade noch auf der Vorderseite der Gruppe sichtbar ist. Zwei Durchmesser sind im Bereich der Windung gemessen worden, den die `untere´ Schlange um den linken Knöchel des älteren Sohnes gelegt hat. Unmittelbar links von diesem `Knoten´ hat die `untere´ Schlange einen Durchmesser von 6,0 cm. Wenn man sich von dort aus nur wenig weiter nach rechts, auf diesen `Knoten´ zu, bewegt, hat die `untere´ Schlange einen Durchmesser von 5,4 cm94.
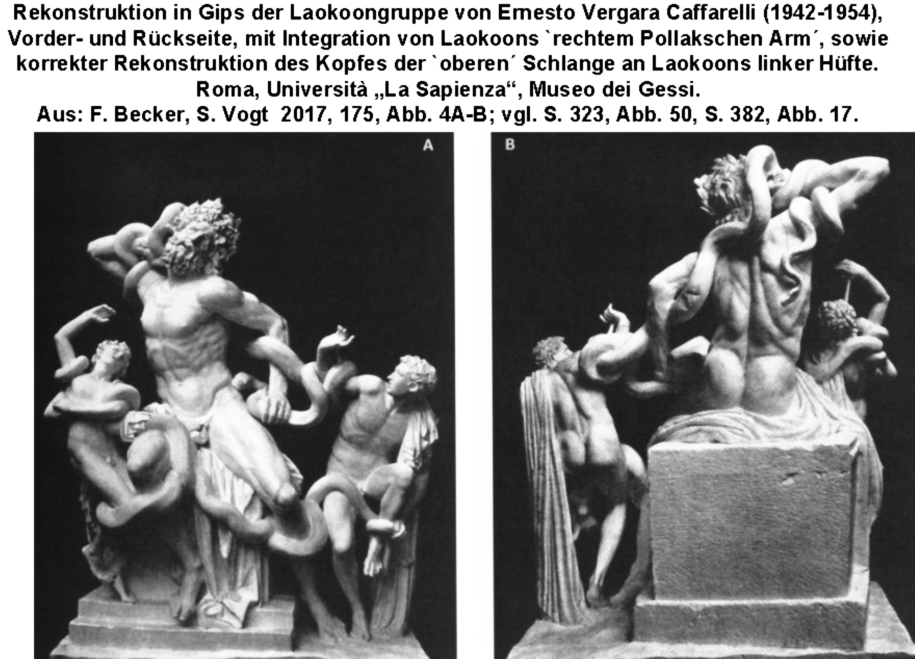
29. Dia. Rekonstruktion in Gips der Laokoongruppe von Ernesto Vergara Caffarelli (1942-1954), Vorder- und Rückseite, mit Integration von Laokoons `rechtem Pollakschen Arm´, sowie korrekter Rekonstruktion des Kopfes der `oberen´ Schlange an Laokoons linker Hüfte. Roma, Università "La Sapienza", Museo dei Gessi. Aus: F. Becker, S. Vogt 2017, 175, Abb. 4A-B; vergleiche S. 323, Abb. 50, S. 382, Abb. 17.
Ich zeige Ihnen diese Rekonstruktion, weil Ernesto Vergara Caffarelli, der bereits den `Pollakschen rechten Arm´ des Laokoon in seine Rekonstruktion integriert hat, eine nach meinem Dafürhalten mögliche Ergänzung des Schwanzendes der `oberen´ Schlange auf Laokoons Rücken vorgelegt hat, die bei ihm bis unter das rechte Schulterblatt des Laokoon reicht.
Magi schrieb, dass in der auf diesem Dia gezeigten Rekonstruktion der Gruppe des Vergara Caffarelli der Kopf der `oberen´ Schlange sehr viel korrekter ergänzt sei als in den früheren Ergänzungen. Diesem Urteil pflichte ich bei, auf Grund der Position der Bosse an Laokoons linker Hüfte, welche es notwendig macht, den Kopf der `oberen´ Schlange auf diese Weise zu rekonstruieren (darauf werde ich unten, zu Dia 39, noch einmal zurückkommen).
Um die Bedeutung von Vergara Caffarellis Rekonstruktion der Laokoongruppe richtig würdigen zu können, muss ich an dieser Stelle einen Vorgriff auf ein Thema von Kapitel II. machen.
Wie wir gleich sehen werden, kann man die bislang vorgelegten Rekonstruktionen der Laokoongruppe in zwei wissenschaftliche `Lager´ einteilen, deren jeweils wichtigste Grundannahmen sich gegenseitig ausschließen:
Zum ersten `Lager´ gehören jene Gelehrte, welche den Kopf der `oberen´ Schlange an Laokoons linker Hüfte annehmen. Zu diesem `Lager´ zählt auch Magi mit seiner Restaurierung des Originals der Gruppe, und Vergara Caffarellis hier gezeigte Rekonstruktion der Laokoongruppe in Gips.
Natürlich sind nur Vertreter dieses ersten `Lagers´ der Ansicht, dass das Schwanzende der `oberen´ Schlange auf Laokoons Rücken fällt, und dass die Bosse unter dem rechten Schulterblatt Laokoons ein Anzeichen dafür sei, dass das Schwanzende der `oberen´ Schlange an dieser Stelle am Rücken Laokoons angehaftet hat.
Das zweite `Lager´ bestreitet, dass die Prämissen, auf denen die Autoren des ersten `Lagers´ ihre Hypothese basieren, valide seien, zu diesem `Lager´ gehören die Autoren der neuen Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe.
Der wichtigste Unterschied zum ersten `Lager´ besteht darin, dass die Vertreter des zweiten `Lagers´ bestreiten, dass die `obere´ Schlange den Laokoon in dessen linke Hüfte beißt. Folglich deuten die Gelehrten des zweiten `Lagers´ die Bosse an Laokoons Hüfte auf andere Weise.
Zweitens bestreiten zu Beispiel die Autoren der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe den Dokumentationswert der frühen Darstellungen der Gruppe, auf denen der Kopf der `oberen´ Schlange an Laokoons linker Hüfte erscheint.
Selbst nehmen Vertreter des zweiten `Lagers´ an, dass sich der Kopf der `oberen´ Schlange statt dessen in der Nähe von Laokoons Kopf befunden habe. Vergleiche dazu ausführlich Susanne Muth (2017b, 340-341, wörtlich zitiert oben, in Anm. 30).
Liverani95 ist der Überzeugung, dass der originale Kopf der `oberen´ Schlange zusammen mit der Laokoongruppe gefunden worden sei, da dieser Schlangenkopf auf sehr frühen Darstellungen der Gruppe erscheine, auf späteren derartigen Abbildungen der Gruppe dagegen nicht mehr wiedergegeben worden sei:
"Al momento della scoperta la statua era sostanzialmente completa: il disegno di Giovanni Antonio da Brescia [vergleiche Kat. 12] e l'incisione di Marco Dente [vergleiche Kat. 42, 45] ci mostrano le mancanze principali: il braccio destro del figlio minore, il destro del Laocoonte e le dita della mano destra del figlio maggiore, mentre era presente la testa del serpente che morde il fianco di Laocoonte, la quale sparirà dalle immagini successive [Hervorhebung von mir]".
Die Federzeichnung eines unbekannten bologneser Künstlers im Museum Kunstpalast in Düsseldorf96, die nach dem 14. Januar 1506 und vor 1508 entstanden ist, gilt manchen Gelehrten als das erste bildliche Zeugnis, das den Zustand der Laokoongruppe im Augenblick ihrer Auffindung zuverlässig dokumentiert.
Die Tatsache, dass der Kopf der `oberen´ Schlange auch auf dieser Zeichnung an Laokoons linker Hüfte genau da erscheint, wo die an dieser Stelle an Laokoons Hüfte vorhandene Bosse dieses Schlangenkopfes es bezeugt (vergleiche hier Dia 26 und unten zu Dia 39), muss, wenn diese Prämisse den Tatsachen entspricht, als sicheres Anzeichen dafür gewertet werden, wie gut auch dieser Künstler die Gruppe gekannt hat.
Im Unterschied zu Paolo Liverani und Tatiana Bartsch, haben Luca Giuliani und Susanne Muth, sowie Saskia Schäfer-Arnold jenen soeben genannten frühen zeichnerischen und graphischen Darstellungen der Laokoongruppe diesen Dokumentationswert abgesprochen.
Dies ist offenbar in Unkenntnis der Tatsache geschehen, dass bereits Filippo Magi den Dokumentationswert dieser frühen Darstellungen der Laokoongruppe über jeden Zweifel erhaben nachgewiesen hat97.
Luca Giuliani und Susanne Muth sowie Saskia Schäfer-Arnold, halten überdies den Kopf der `oberen´ Schlange, der auf diesen Darstellungen erscheint, nicht für den originalen Schlangenkopf, sondern für eine Ergänzung der Renaissance.
Und, was im hier betrachteten Zusammenhang von noch größerer Bedeutung ist: Wie wir der weiteren Argumentation der Gelehrten der Berliner Ausstellung von 20016-2018 noch entnehmen werden, hat, ihrer Meinung nach, dieser Renaissance-Restaurator den Kopf der `oberen´ Schlange im Übrigen an der vollkommen falschen Stelle angenommen.
Wie wir im Folgenden sehen werden, kann man die soeben genannte Hypothese der Autoren der Berliner Ausstellung von 20016-2018 als jene Grundannahme definieren, welche ihrer neuen Rekonstruktion der Laokoongruppe zu Grunde gelegen hat, wobei Susanne Muth diese Hypothese bereits in ihrem diesbezüglichen Aufsatz von 2005 formuliert hatte. Diese Prämisse lautet:
Erst in der Renaissance sei entschieden worden, dass die `obere´ Schlange Laokoon in dessen linke Hüfte beisst.
Von dieser Hypothese ausgehend, haben die Autoren der Berliner Ausstellung dann im Folgenden versucht zu bestimmen, an welcher Stelle die `obere´ Schlange, im originalen Zustand der Gruppe, den Laokoon tatsächlich angegriffen hatte.
Neu an der Argumentation der Autoren der Berliner Ausstellung, im Unterschied zu der von Muth (2005) zuvor formulierten Hypothese, ist überdies, dass diese Autoren der Überzeugung sind, dass der Renaissance-Restaurator das Volumen der Windung der `oberen´ Schlange im Bereich von Laokoons linker Hand verringert habe, um auf diese Weise seine Platzierung des Kopfes der `oberen Schlange´ an Laokoon Hüfte plausibel erscheinen zu lassen (ich werde auf die letztere Prämisse unten, in Anm. 100, und im Text zu Anm. 107, noch einmal zurückkommen).
Wie bereits oben (zu Dia 25) gesagt, geht aus Liveranis 98 Diskussion der neuzeitlichen Restaurierungen der Gruppe Folgendes hervor. Der ergänzte Kopf der `oberen´ Schlange, den wir heute noch an Magis Restaurierung der Gruppe sehen, ist ein Werk Agostini Cornacchinis (beziehungsweise ein Gipsabguss dieser Ergänzung).
Cornacchini war beauftragt worden, jene Ergänzungen des Renaissance-Restaurators zu ersetzen, die im Laufe der Zeit entweder bereits verloren gegangen, oder zumindest stark beschädigt waren. Demnach besaß, nach Auffassung Liveranis, die `obere´ Schlange der Laokoongruppe im Laufe der Zeit drei verschiedene Köpfe:
Der erste, originale, der auf den frühen Zeichnungen und Graphiken der Renaissance noch dargestellt worden war, wurde, da er offenbar verloren ging oder verworfen wurde, durch eine Ergänzung des Schlangenkopfes des Renaissance-Restaurators ersetzt (diese Ergänzung umfasste den Kopf der `oberen´ Schlange und den unmittelbar daran anhaftenden Teil ihres Halses; siehe oben, Anm. 92).
Dieser zweite (ergänzte) Schlangenkopf ging später ebenfalls verloren oder war beschädigt worden.
Der dritte, von Cornacchini ergänzte Kopf der `oberen´ Schlange, ist noch erhalten (zumindest in Form des Gipsabgusses dieser Ergänzung, den Magi im Zuge seiner Restaurierung in das Original integriert hat). Auch Cornacchinis Ergänzung umfasst den Kopf der `oberen´ Schlange und den unmittelbar daran anhaftenden Teil ihres Halses: Wie bereits gesagt, hat Magi in seine Restaurierung der Laokoongruppe aber nicht Cornacchinis Marmororiginal dieser Ergänzung integriert, sondern einen danach angefertigten Gipsabguss (siehe hier Dia 27; s. u., zu Dia 39).
Die soeben skizzierte Kontroverse zwischen den beiden `Lagern´, in welche man die Laokoonforschung in Bezug auf die Diskussion der Rekonstruktionen der Gruppe und die Restaurierung des Originals einteilen kann, läßt sich demnach auf die folgende Frage reduzieren:
Beisst die `obere´ Schlange den Laokoon tatsächlich in seine linke Hüfte, wie es Magi in seiner Restaurierung des Originals vorträgt (vergleiche hier Dias 5; 6; 18; 39) - oder nicht? Der Versuch, diese Frage zu beantworten, führt uns zum zweiten Kapitel.
12 vergleiche zum Gips der Laokoongruppe im Akademischen Kunstmuseum - Antikensammlung der Universität Bonn, D. Piekarski: "52 Laokoon-Gruppe Inv. 9 Erworben: 1820 aus Paris; r.[echter] Sohn aus Berlin 1957 ...Maße: H 1,84 m ...", in: J. BAUER, W. GEOMINY 2000, 193-199, Abb. 194-200; vergleiche S. 197: "Der Bonner Abguß der Laokoon-Gruppe dürfte mit dieser Geschichte einmalig sein; er vereint in `eklektischer´ Manier Ergänzungen und Ausbesserungen aus vier Jahrhunderten".
13 vergleiche O. ZWIERLEIN 1989; F. BURANELLI 2006a, 49 mit Anm. 3; S. MUTH 2017b, 32-33, S. 335 mit Anm. 2. Vergleiche auch W. GÖRLER 1990, den ich leider in meinen früheren Publikationen zur Laokoongruppe übersehen hatte. Ich danke Franz Xaver Schütz für den Hinweis auf diese Publikation.
Nach der überzeugenden Auffassung von W. GÖRLER 1990, 180; vergleiche S. 176 mit Anm. 1, kann man aus dem Pliniuszitat (nat. hist. 36,37 keineswegs herauslesen - wie nach wie vor von einigen Gelehrten behauptet wird - dass es sich bei der Marmorskulptur eines Laokoon, die Plinius sah, um die Kopie nach einem Bronzeoriginal gehandelt habe. GÖRLER, op.cit, wendet sich gegen einige Behauptungen von Bernard Andreae, die sich auf dessen Interpretation von Plinius, nat. hist. 36,37, beziehen, unter anderem, die hier soeben erwähnte. GÖRLER zitiert dazu in seiner Anm. 1 unter anderem: B. ANDREAE 1988.
S.G. SCHMID 2017, 388, schreibt: "Die Gruppe wurde nachweislich nicht in einem Haus/ Palast des Titus gefunden (Essay 29)". Er verweist damit auf den Beitrag von J. BARTZ, S. MULATTIERI 2017 im selben Band (für eine Diskussion dieses Beitrags, siehe unten, Kapitel III.8., zu Anm. 152, weitere Diskussionen in Kapitel IV.1.). Das Fehlen einer eigenen Diskussion der einschlägigen neueren Literatur zum Fundort der Laokoongruppe im Beitrag von S.G. SCHMID 2017, seine unmittelbar an die zitierte Passage anschließenden Bemerkungen zum Fundort der Gruppe, besonders seine expliziten Erwähnungen der Domus Aurea und der Trajansthermen als ihren möglichen Fundorten, zeigen, dass S.G. SCHMID auch hierin J. BARTZ, S. MULATTIERI 2017 folgt, und die neueren Forschungen zu dieser Thematik ebensowenig selbst zur Kenntnis genommen hat.
Vergleiche hierzu, C. HÄUBER, F.X. SCHÜTZ 2004; die Beiträge in F. BURANELLI et al. 2006: P. LIVERANI 2006; F. BURANELLI 2006a, C. HÄUBER 2006, sowie C. HÄUBER 2009; HÄUBER 2014, sowie R. VOLPE, A. PARISI 2010a; R. VOLPE, A. PARISI 2010b.
S.G. SCHMID 2017, 392, folgt mit seinem Urteil: "... kennen wir den ursprünglichen Aufstellungsort des Laokoon nicht, wir fassen ihn lediglich in späteren Aufstellungen in einer Residenz des Titus (Plinius) und im Bereich der Trajansthermen (Fundort) (Essay 29)", wiederum J. BARTZ, S. MULATTIERI 2017. Ich werde unten, im Kapitel III.8., zu Anm. 153, und im Kapitel IV.2.2. darauf zurückkommen.
Auf S. 390-392, diskutiert S.G. SCHMID am Beispiel der beiden Teilstücke, aus denen der jüngere Sohn gefertigt worden ist, dass die Künstler der Laokoongruppe ihre Skulptur auf identische Weise aus Teilstücken zusammengefügt haben, wie dies an der Skyllagruppe in der Grotte von Sperlonga der Fall ist, bei der es sich um ein inschriftlich gesichertes Werk jener drei Rhodier handelt, die nach Plinius auch die Laokoongruppe geschaffen haben sollen; vergleiche S. 389, "Abb. 3A-B Sperlonga, Skyllagruppe, Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga"; vergleiche S. 390, "Abb. 4 Sperlonga, Polyphemgruppe [corr.: Skyllagruppe], Werk des Hagesandros, Polydoros und Athanodoros, Künstlerinschrift am Ruderkasten". Auf den Seiten 392 und 393 mit Anm. 24, datiert S.G. SCHMID 2017 die Laokoongruppe: "in die Jahrzehnte 40-20 v. Chr."; sein Fazit auf S. 395 lautet: "Festzuhalten gilt hingegen, dass die detaillierte Analyse der Originalkomponenten des Laokoon einige kompositorische und technische Besonderheiten zum Vorschein brachte, welche es als sicher erscheinen lassen, dass es sich tatsächlich um das von Plinius beschriebene Meisterwerk der rhodischen Bildhauer Hagesandros, Polydoros und Athenodoros handelt. Dadurch wird der direkte Vergleich mit der Skyllagruppe erst legitimiert, welcher eine Datierung zwischen 40-20 v. Chr. zur Folge hat".
Interessanterweise waren zu denselben Resultaten, wie sie S.G. SCHMID 2017, 395, in seinem Fazit zusammenfasst, bereits einige der oben erwähnten Autoren gelangt (vergleiche hier unmittelbar anschließend, sowie unten, Anm. 63 und zu Dia 48), deren Forschungen zum Fundort der Laokoongruppe S.G. SCHMID übersehen hat. Erfreulich daran ist, dass S.G. SCHMID die Resultate dieser Gelehrten bestätigt, und das, obwohl er dieses Thema somit vollkommen unbeeinflusst von den Erkenntnissen dieser Autoren selbst recherchiert, und seine eigenen Ergebnisse zum Teil auf ganz andere Beobachtungen gegründet hat.
Vergleiche F. BURANELLI et al. 2006, 119, cat. "1 Athanodoro, Agesandro e Polidoro Laocoonte 40-20 a.C. ... Musei Vaticani, Cortile Ottagono, inv. 1959 ..." (P. LIVERANI); vergleiche S. 119, cat. "2 Iscrizione degli artisti rodii Athanodoro, Agesandro e Polidoro (calco) ... Dalla Grotta di Tiberio a Sperlonga, scavo 1957 Museo Nazionale di Sperlonga" (P. LIVERANI); vergleiche S. 192, cat. "90, Braccio Pollak 40-20 a. Chr. ... Musei Vaticani, Inv. 1064" (P. LIVERANI).
14 Vergleiche F. BURANELLI 2006a, 49 mit Anm. 1.
15 so zur Bedeutung vom Titel `imperator´ des Titus bereits F. MAGI 1980, 32 mit Anm. 13; Vergleiche W. GÖRLER 1990, 176: "Nachdem Plinius den Laokoon im Hause des Imperators Titus erwähnt hat ..."; C. HÄUBER 2006, 41 mit Anm. 1, 2 (mit Literatur); C. HÄUBER 2009, 314 mit Anm. 37-46 (mit Literatur) C. HÄUBER 2014, 622-623, mit Anm. 116-124 (mit Literatur). Zur Rückkehr des Titus nach Rom im Jahre 71 n. Chr., vergleiche C. HÄUBER 2014, 622 mit Anm. 121 (mit Literatur). Vergleiche S. MUTH, R.F. SPORLEDER 2017, 46; J. BARTZ, S. MULATTIERI 2017, 445 mit Anm. 1, 2.
16 vergleiche D. KIENAST, W. ECK, M. HEIL 2017, 101: "Vespasian (1. Juli 69-23. Juni 79)"; S. 105: "Titus (24. Juni 79-13. Sept.[ember] 81); "Wichtige Einzeldaten Aug.[ust]/Sept.[ember] 70 Einnahme von Jerusalem. T. CAESAR VESPASIANUS IMPERATOR ...".
17 vergleiche F. BURANELLI 2006b, 42-43; A. HENNING 2017, 417-419, Abb. 1.
18 C. HÄUBER 2014, 619-620, 623. So auch S. MUTH 2017b, 337-338.
19 C. HÄUBER 2014, 619-620, 623. - Vergleiche zur Bedeutung des Altars der Laokoongruppe W. FUCHS (1963, 163).
20 vergleiche B. ANDREAE 1988; C. HÄUBER 2014, 619, 626, 782. Zur Adoption des Octavian/ Augustus durch Julius Caesar, vergleiche C. HÄUBER 2017, 376 Anm. 203; siehe unten, Anm. 167. - Mit der hier wiedergegeben Meinung bin ich Andreae (1988) gefolgt, der sich diesbezüglich aber geirrt hatte, wie A. GEYER (1991, 62) richtig stellen konnte. Für das wörtliche Zitat aus ihrer Rezension von Andreae 1988, und eine Diskussion des Problems, siehe unten, Kapitel IV.2.1.
Inzwischen hat Eric R. Varner (2025, 398-399) Angaben zur `Genealogie´ des mythischen trojanischen Königshauses gemacht,, die mir zuvor unbekannt gewesen sind: "As the son of Anchises' brother Acoetes, Laocoon is [Seite 399] cousin to Aeneas [Hervorhebung von mir]". Leider gibt Varner nicht an, wo er diese Information gefunden hat. Mein Dank gilt Franz Xaver Schütz, der diesbezüglich im Internet fündig geworden ist: Es handelt sich um ein Zitat aus Gaius Iulius Hyginus' Werk Fabulae; vergleiche unten, Kapitel III.4.1, zu Punkt 11.). .
21 vergleiche F. BURANELLI 2006a. Beide Zitate sind von S. 51, mit Anm. 14 (mit Literatur). Vergleiche zu diesem Projekt Julius II. auch A. HENNING, S. MUTH 2017; sowie G. SPINOLA 2021, 122-123 mit Anm. 4, 5.
22 F. BREIN 1978, 38, mit Anm. 42: "Die Maße nach S. Ferri, ArchCl 2, 1950, 67". Mein herzlicher Dank gilt Brunilde Sismondo Ridgway, die mich im Sommer 2002 auf diesen Aufsatz hingewiesen hat; vergleiche B. SISMONDO RIDGWAY 2001, 569; sowie Herrn Dr. Walter Trillmich, der mir freundlicherweise im Sommer 2002 eine Photokopie von BREIN's Aufsatz geschickt hat. Vergleiche G. LAHUSEN 1999, 300, der dieselben Maße der beiden Schlangen, wie BREIN, op.cit., nennt (ohne Angabe der Quelle).
23 S. MUTH 2005, 90.
24 vergleiche P. LIVERANI 2006, 24-25, mit Anm. 8, 9, Figs. 4; 5 [= hier Dia 7] ; s. 24: "Un affresco è nella casa del Menandro (fig. 4) e si data agli anni 60-70 d.C., l'altro, del secondo quarto del I sec. d.C., viene dalla casa appunto detta del Laocoonte [mit Anm. 8] (fig. 5) il padre e i figli non formano gruppo, ma vengono assaliti separatamente dai serpenti. Il sacerdote traiano, riccamente vestito, assiste impotente alla morte dei figli e l'altare su cui si trova non gli offre alcuna salvezza ...". In seiner Anmerkungen 8 zitiert er Literatur.
Vergleiche S. MUTH 2017b, 338: "Dass Laokoon an diesem Altar nicht die Hilfe des Gottes sucht, ist eigentlich nur aus einem Grund zu erklären. Es muss der Altar desjenigen Gottes sein, der auch die Schlangen gegen Laokoon schickt - und bei dem Laokoon erst gar nicht versuchen muss, noch um Hilfe zu flehen, da es der Gott selbst ist, der ihn bestraft. Womit wir bei Apoll sind, der seinen eigenen Priester bestraft. Der Statuengruppe lag also die Version vom frevelnden Laokoon zugrunde. Gleichfalls wird unserem Betrachter aber auch aufgefallen sein, dass die Bildhauer diese Thematik überraschenderweise nicht allzu markant betont haben. Laokoon ist kaum deutlich als Priester wiedergegeben. Die Bildhauer wählten für ihn nicht die geläufige Priester-Ikonographie mit einem langen Gewand - wie Laokoon etwa in den Wandgemälden in Pompeji erscheint (Abb. 5.6; Taf. 26.27)"; vergleiche auch S. 349-350; sowie A. HENNING 2017, 428-429, Abb. 7; 8; Taf. 26; 26; S. PEARSON 2017, passim.
25 vergleiche die beiden Rekonstruktionszeichnungen der Laokoongruppe von L. POLLAK 2005, Fig. 1 und 2, der diese Grate wiedergegeben hat, sehe unten, Dia 22. Dagegen schrieb F. BREIN 1978, 38, Folgendes: "Auch die kantige, nicht drehrunde Bildung der Schlangenleiber stimmt mit der Natur überein".
26 die hier auf den Dias 8-10 gezeigten Aufnahmen von Giovanni Ricci Novara sind in den beiden Publikationen F. BURANELLI et al. 2006 und F. BURANELLI 2006b auf Tafeln publiziert, die nicht nummeriert sind, für Kommentare zu diesen Aufnahmen, siehe unten, Anm. 86.
27 vergleiche F. BURANELLI et al. 2006, 122-123, Kat. "8 Virgilio Opere Italia centrale Roma Sec. IV/V ... Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3225" (M. Buonocore).
28 F. BREIN 1978, 38 mit Anm. 42; G. LAHUSEN 1999, 300.
29 vergleiche MULTIMEDIA-LEXIKON 2001, Universal Lexikon s.v. Schlangen.
30 hierbei handelt es sich um Informationen, die uns Prof. Wolfgang Böhme bei unserem Gespräch mit ihm am 13. November 2002 gegeben hat. Vergleiche zur Taubheit von Schlangen auch O. KELLER 1913; vergleiche KELLER 1963, 304.
Nach W. KOCH 1927, 123-124, erbeutet eine Riesenschlange ihr Opfer wie folgt: Wenn die Riesenschlange ein Opfer sieht, bringt sie, die vorher ihren Körper aufgerollt hatte, sich selbst in größtmögliche Nähe des Opfers, diese Ringe (ihres Leibes) können neben- oder übereinander liegen. Sie legt den Hals in Windungen, um die für den Vorstoß nötige Länge zu gewinnen. "Urplötzlich schnellt der Schlangenkopf vor, gleichzeitig, nicht früher, öffnet sich der Rachen, und ehe das Opfer noch weiß, was ihm droht, ist es gepackt und zwischen ein oder zwei Ringe des Schlangenleibes gepreßt ... Die Schlange packt das Tier und rollt in demselben Augenblick das vordere Ende ihres Leibes ein, indem sie den Kopf mit der Beute nach vorwärts wendet und mit ihm und ihr ebenso viele Kreise beschreibt, als sie Schlingen um die Beute legen will. Aber die Sekunde, bei deren Beginn der Vorstoß erfolgte, ist noch nicht verstrichen, wenn das gepackte Opfer bereits in der tödlichen Umstrickung sich befindet ... [Hervorhebung von mir]". - Im Folgenden beschreibt KOCH, op.cit., dass durch den furchtbaren Druck, den die Schlange mit den Schlingen ihres Körpers ausübe, das Opfer erstickt werde. Um diesen Prozess noch zu beschleunigen, können Riesenschlangen auch ihr enormes Gewicht einsetzen: indem sie einige Schlingen ihres Körpers auf das Opfer legen, erhöhen sie damit den Druck auf das Opfer.
S. MUTH 2017b, 340-341 behauptet dagegen, wie ich meine irrtümlich, Folgendes über die `obere´ Laokoonschlange: "Was macht ihre Kollegin [bezogen auf die `untere´ Schlange] oben? Auch sie [Seite 341] startet zunächst spielerisch, ähnlich wie die untere Schlange, ohne dass zu erahnen ist, wie furchtbar ihr Angriff enden wird. Sie windet sich mit ihrem Ende (wie wir es in unserer Rekonstruktion vorschlagen - Abb. 9-12; Taf. 20-23 [vergleiche hier Dias 31; 32]) um den rechten Unterarm des jüngeren Sohnes, ihr Schwanzende fällt auf seinen Kopf herab; von hier zieht sie hinüber zu Laokoon und schlängelt sich in vergleichsweise freiem Verlauf hinter seinem Rücken entlang, um dann auf seiner linken Flanke wieder nach vorne zu ziehen; dabei umwickelt sie seinen linken Unteram und wird von seiner linken Hand kraftvoll gepackt und festgehalten - was aber eine Schlange wenig aufzuhalten vermag, wenn sie noch gut weiter 5-6m Schlangenkörper zum Einsatz bringen kann; genau das kostet die Schlange aus: Sie windet sich zunächst kompliziert um den rechten Arm des älteren Sohnes, vollführt hier eine gekonnte Knotenbildung, schwingt sich dann wieder hinüber zum Laokoon, legt sich kraftvoll über dessen linken Unterarm und hindert diesen in seiner Bewegungsrichtung nach unten; sodann kriecht sie hoch in dessen Rücken, schiebt seinen Oberkörper an seinem linken Schulterblatt nach vorne, schlängelt sich hinüber zur rechten Schulter, um sich dann von hier kraftvoll abzudrücken und zum finalen Angriff überzugehen: Sie legt sich über den rechten Unterarm des Laokoon, zieht zwischen Unter- und Oberarm hindurch nach hinten und schlängelt sich unter dem Oberarm wieder nach vorne; dabei preßt sie mit gewaltiger Kraft dessen Ober- und Unterarm zusammen, schiebt den Unterarm nach hinten aus dem Ellbogengelenk, drückt den gesamten Arm Richtung Körper ihres Opfers, zieht ihn zugleich mit mächtiger Gewalt nach hinten und hält ihr Opfer, einer Marionette gleich, ohnmächtig fixiert, um zum finalen Todesstoß überzugehen: bedrohlich nähert sie sich seinem Hals - und wird im nächsten Moment zubeißen [Hervorhebung von mir]". - Für ihre Behauptungen bezüglich des Verhaltens von Schlangen, worauf unter anderem ihre Rekonstruktion der Laokoongruppe beruht, zitiert S. MUTH 2017b, 340-341 keinerlei wissenschaftliche Literatur. Wie Muths hier zitierte Beschreibung der `oberen´ Schlange zeigt, glaubt sie, dass sich der Kopf dieser Schlange links neben Laokoons Hals befinde. Der gesamten Rekonstruktion der Laokoongruppe von S. Muth und ihrem Team (vergleiche S. MUTH 2017a) habe ich widersprochen, vergleiche unten, Kapitel II. Vergleiche auch unten, Anm. 106.
31 mündliche Mitteilungen von Prof. Böhme am 29. Mai 2002; vergleiche zu den `Knoten´ der Laokoonschlangen oben, zu Dia 6. Dagegen hat S. MUTH 2005, 90, Folgendes behauptet: "Was bei der Konfrontation des kleinen Herakles mit den Schlangen [vergleiche ihre Abb. 8 auf S. 90] den Bildhauern keine Mühe macht, wird beim Laokoon zum ikonographischen Problem: Laokoon ist ein Mann, er ist stark, und trotzdem sollen die Schlangen siegen. Wie lösten die drei rhodischen Bildhauer diese Aufgabe? Zunächst reizten sie das visuelle Potential der Schlangen dort aus, wo es tatsächlich am größten ist, und zwar indem sie nicht ihre bedrohliche Stärke und Überlegenheit thematisierten, sondern sie die hohe Kunst des Fesselns üben ließen - die Schlangen von einer Länge von 6-7 m gut beherrschen ... [Hervorhebung von mir]". - Diese völlig falsche Behauptung hat S. MUTH 2017b, 348, wortgleich wiederholt. Für diese Behauptung zitiert die Autorin keinerlei wissenschaftliche Literatur.
32 `richtig´ an der Darstellung der `Knoten´ der Laokoonschlangen ist, was W. KOCH 1927, 120-121, schrieb: "Riesenschlangen, Nattern und andere kletternde Arten der Ordnung ruhen gern gemeinschaftlich im Gezweige und verknäueln sich dabei nicht selten zu einem dem Auge unentwirrbaren Ballen"; vergleiche seine Abbildung gegenüber S. 128: "Schlafgesellschaft von 43 Kreuzottern" (!).
Die beiden Schlangen der Laokoongruppe sind aber in einer Weise um die Gliedmaßen der drei Protagonisten geknotet, wie es nur die Künstler am Modell ausführen konnten, keinesfalls aber die Schlangen selbst.
Meine hier gemachte Behauptung können Sie leicht nachvollziehen, wenn Sie auf der Vorderseite der Gruppe dem Verlauf der beiden Schlangen um die Gliedmaßen der drei Männer herum mit den Augen folgen. Ich habe deshalb für mein kleines AIS zum Thema der Laokoonschlangen die `untere´ Schlange der Laokoongruppe gefilmt, indem ich dieser Schlange mit-den-Augen-gefolgt bin; vergleiche die beiliegende CD in: C. HÄUBER, F.X. SCHÜTZ 2004, sowie die `Standphotos´ aus diesen Videosequenzen auf dem Titelbild des Bandes und auf S. 114 (vergleiche hier Dia 3).
33 F. MAGI 1969, 24; vergleiche S. MUTH 2017b, 35-36 (wörtlich zitiert unten, Anm. 103).
34 G. LAHUSEN 1999, 300.
35 vergleiche W. BÖHME, N.N. ŠČERBAK 1993, passim; p. 373 (zur Größe: "bis zu 2600 mm", mit Angabe von Literatur); pp. 376-381, zur Verbreitung, mit Abb. 71, wozu Griechenland und Italien gehören; W. BÖHME 2015, passim. Claudia Valeri war so freundlich, mir zu sagen, dass diese Schlangenart auf Italienisch `Cervone´ heißt.
36 vergleiche W. BÖHME 2015, 4 mit Abb. 4, S. 94, Abb. 7.
37 O. KELLER 1913; vergleiche KELLER 1963, 288, 289.
38 das hat uns Prof. Böhme anläßlich unseres Gespräches am 29. Mai 2002 erzählt.
Vergleiche W. BÖHME, N.N. ŠČERBAK 1993, 393: "Anders klingen die diesbezüglichen Beobachtungen an E. quatuorlineata (s. str.) [das heißt, der Vierstreifennatter]. Hier wird, auch beim Fang, ihre Beißunlust betont, desgleichen die fehlende Fluchtbereitschaft: So wurde sie nach WERNER (1938*) auf Mykonos öfter sowohl von Menschen als auch von Reit- und Tragtieren ... - auch ohne böse Absicht - zertreten. Sie sei beißunlustig, und einmal habe er sich in Dalmatien ein frischgefangenes Tier um den Hals gehängt, das dort den ganzen Rückweg ruhig in dieser Lage blieb. Auch BUCHHOLZ (1955) rollte sich mangels Transportbeutels auf Ios ein Tier nach dem Fang um das Handgelenk, wo es 20 min. lang keine Gegenwehr leistete. Mit dieser Friedfertigkeit gerade der gestreiften Populationen dürfte ihre Rolle bei den christlichen Prozessionen in Cocullo/Abruzzen (BRUNO 1971) und im Asklepioskult in der klassischen Antike (BODSON 1981) zusammenhängen, die sich sicherlich, trotz des irreführenden Namen[s], vorwiegend auf E. quatuorlineata und nicht auf die Äskulapnatter (E. longissima) bezog"; siehe unten, Anm. 57.
39 so E. KÜSTER 1913, 134-135: "Asklepios wurde also, wie wir aus dieser Erzählung ersehen [mit Anm. 2], noch bis in die historische Zeit mit der Schlange identifiziert [mit Anm. 3].
[Vergleiche seine Anm. 3: "Zur Veranschaulichung und zugleich als Beleg dafür, daß der Glaube an die Heilkraft der Schlange allein als Hypostase des Gottes noch in der Mitte des 5. Jhs. kräftig war, mag ein interessantes (attisches?) Relief in Kopenhagen mit einzigartiger Darstellung angeführt werden (ich verdanke die Photographie sowie die Erlaubnis der Publikation des Reliefs der Liebenswürdigkeit des Direktors der Kopenhagener Glyptothek, Dr. Fr. Poulsen): ein älterer Mann, anscheinend ein Kranker, wird auf einer Tragbahre von drei nackten Jünglingen in die Höhe gehoben und einem Baum genähert, in dessen Ästen sich eine große Schlange windet. Der Kranke, halb aufgerichtet, streckt wie hilfebittend seine Rechte zur Schlange empor, deren Kopf in einem Astloch des Baumes versteckt ist. Zwei weitere Jünglinge, bekleidet, eilen von links und rechts in symmetrischer Darstellung auf den Baum in der Mitte zu und sind in merkwürdiger Handlung begriffen: beide scheinen mit [der] erhobenen Rechten einen faustgroßen Stein, den sie in der Hand tragen, gegen Baum und Schlange werfen zu wollen. Ich erkläre mir die Szene so, daß ein Kranker bei der heiligen Schlange, die im Baum ihre Behausung hat, Hilfe und Heilung sucht, die beiden Jünglinge links und rechts sind offenbar beauftragt, die Schlange durch Steinwürfe gegen den Baum zum hilfreichen Erscheinen zu zwingen; sie sind noch werfend dargestellt, weil sie dadurch die Schlange, welche bereits ihren Kopf wieder in das Astloch gesteckt hat, verhindern wollen, daß sie gänzlich in ihre Behausung zurückkriecht" (Hervorhebung von mir).]
Daher dürfen wir für den älteren, mantischen Asklepios mit umso größerer Sicherheit Schlangengestalt voraussetzen, zumal auch mit der Inkubation, die zu den ältesten Bestandteilen des Heilorakels gehörte, die Vorstellung eines schlangengestaltigen Erdgeistes verbunden war, der persönlich die Wünsche der Ratsuchenden anhörte [Hervorhebung von mir]".
KÜSTER (1913, 134-135) hat meines Erachtens dieses Relief in einigen sehr entscheidenden Punkten falsch gedeutet: Der Teil der heiligen Schlange, der seiner Meinung nach `in dem Astloch verschwindet´, ist nicht ihr Kopf, sondern ihr Schwanz. Ihr Kopf erscheint (von KÜSTER unbemerkt) im Relief unmittelbar über diesem Astloch, ist im Profil nach rechts gegeben, und dem Kranken zugewandt (siehe Dia 13, im Kasten oben rechts). Dass diese hier vorgetragene Deutung den Tatsachen entspricht, sieht man meines Erachtens daran, dass alle auf dem Relief dargestellten Männer in die Richtung dieses Schlangenkopfes blicken. Demnach verschwindet die Schlange nicht etwa in ihrem hohlen Baum, sie ist, ganz im Gegenteil, soeben aus diesem Astloch hervorgekrochen, beziehungsweise noch dabei, hervorzukommen, und wendet sich nun dem Kranken zu, offenbar in der Absicht - so, wie ich glaube, die im Relief vorgetragene Geschichte einer tatsächlich erfolgten Heilung - den Kranken `anzuhören´ oder zu `heilen´.
Es ist ja im Übrigen schwer vorstellbar, dass dieser hier als krank geschilderte Mann, sein marmornes, und sicher auch noch farbig gefasstes (und mit einer aufgemalten Inschrift versehenes?), und somit insgesamt sehr teures, Weihrelief aus einem anderen Anlaß, als aus Dankbarkeit für den erhörten Wunsch, `Gehör zu finden´, oder `wieder gesund zu werden´, in das Heiligtum dieses Heilgottes/ dieser Schlange geweiht haben sollte - oder andernfalls, um einen derartigen Wunsch zu formulieren.
Wenn meine Deutung zutrifft, dann könnten die jungen Männer, welche Steinen in den Händen halten, darauf hinweisen, wie man in diesem Heiligtum gewohnt war, die heilige Schlange zum Erscheinen zu bewegen: Durch Steinwürfe an den hohlen Baum, in welchem das Tier lebte. Dass dem so ist, schließe ich aus dem Faktum, dass der Künstler hervorhebt, dass die Schlange dabei ist, aus ihrem Baum `hervorzukommen´ - meines Erachtens deshalb, weil sie `gerufen´ worden ist - der Künstler zeigt ja deutlich, dass der Schwanz der Schlange noch im Baum steckt. Sie war demnach vor diesem `Ruf´ für die hier gezeigten Männer nicht sichtbar gewesen, weil sie sich in ihrem hohlen Baum befunden hatte. Es handelt sich demnach um eine kontinuierende Darstellung, die mehrere, in Wirklichkeit zeitlich voneinander verschiedene Phasen eines Geschehens so wiedergibt, als seien sie gleichzeitig erfolgt. Das heißt, nicht nur im Fall der Laokoongruppe, sondern auch hier, läuft im Kopf der Betrachter in gewisser Weise ein `Film´ ab. - Ich danke Franz Xaver Schütz für diesen Hinweis.
Wir haben oben bereits gehört (siehe zu Anm. 30), dass Schlangen taub sind, ihre Lebensweise auf der Erde hat jedoch dazu geführt, dass sie ein sehr feines Gespür für Erschütterungen entwickelt haben. O. KELLER 1913; vergleiche KELLER 1963, 296, führt Beispiele an, die zeigen, dass diese Fakten in der Antike unbekannt waren. So haben sich zum Beispiel viele Ägypter Schlangen als Haustiere gehalten. Diese Personen riefen ihre Schlangen mit Klatschen der Hände herbei, die Schlangen erschienen auch auf diese Signale hin. Aber offensichtlich nicht wegen der Geräusche, welche diese Menschen gemacht haben, um die Schlangen zum Hervorkommen zu bewegen, sondern auf Grund der von diesen Personen verursachten Erschütterungen.
Wolfgang Böhme, dem ich eine frühere Fassung meines Textes geschickt hatte, antwortete mir darauf per Email vom 15. März 2019:
"2. Ganz Ihrer Meinung bin ich dagegen bei dem Relief mit der dem Patienten zugewandten Schlange. Die ist sicher als Asklepiosschlange, also Vierstreifennatter zu deuten und beeindruckt mich. Gedruckt gesehen habe ich dieses Relief aber bisher nirgendwo [Hervorhebung von mir]".
40 siehe oben, Anm. 39.
41 vergleiche dazu W. BÖHME 2015, 92-93.
42 siehe hier Anm. 38, 39, 57.
43 vergleiche O. KELLER 1913; vergleiche 1963, 289 mit Anm. 246.
44 siehe unten, Anm. 57.
45 so O. KELLER 1913; vergleiche KELLER 1963, 284; vergleiche W. BÖHME 2015, 94 (siehe unten, Anm. 57).
46 so O. KELLER 1913; vergleiche KELLER 1963, 284.
47 dies hat mir freundlicherweise Herr Prof. Ritter bestätigt, der diese Wandmalerei kennt - als ich diese Frage während meines Vortrags gestellt hatte. Vergleiche zu den Schlangen auf derartigen Wandmalereien, T. FRÖHLICH 1991, 56-61: "5. Die Schlangen"; vergleiche zur hier gezeigten Wandmalerei, S. 292, Kat. "L 98 Pompeji VII oder VIII. NA 8905. Genaue Herkunft unbekannt (mit Anm. 74) ... Dat.: Vierter Stil".
48 am 29. Mai 2002.
49 W. Böhme 2015, 91-92, Abb. 1 (auf dieser Abbildung ist das Detail dieses Schlangenkopfes demnach versehentlich seitenverkehrt wiedergegeben worden).
50 vergleiche W. BÖHME 2015, 91-92, Abb. 1; 3.
51 diese Beobachtungen hat Francesco Buranelli am 26. April 2018 vor dem Original der Laokoongruppe gemacht; vergleiche hier Dias 19, 20, 26, 38.
52 vergleiche hier Dias 6, 12, 13.
53 vergleiche W. BÖHME 2015, 95-96 mit Abb. 9 und 10. Vergleiche für diese unterlebensgroße Statue der Salus im Römisch-Germanischen Museum Köln (Inv. Nr. 0241), die "1872 in den Thermen des Flottenlagers Alteburg in Köln-Marienburg" entdeckt worden ist, jetzt: D. KREIKENBOM, in: J. LIPPS et al. 2023, 25-27, mit Anm. 23, Abb. 14-15 (das Zitat stammt von S. 25). Diese Publikation ist der Statuenreplik der Salus vom gleichen Typus im Landesmuseum Mainz gewidmet (Abb. 3; 5-11; 32; 34; 36), die erst am 15.10.2020 "im Mainzer Zollhafen" gefunden worden ist (so J. LIPPS und M. WITTEYER, S. 8); vergleiche S. 32-45: J. LIPPS und D. KREIKENBOM: "5. Das Statuenschema Mainz/Köln: Entstehung und Bedeutung". Leider ist im Fall der beiden Repliken dieses Statuentypus der Salus in Köln und Mainz jeweils der Kopf nicht erhalten.
54 vergleiche O. KELLER 1913; vergleiche KELLER 1963, 296.
55 vergleiche W. BÖHME 2015, 96-97: "Die Schlangen-Prozession von Cocullo in den Abruzzen", mit Titelbild und Abb. 11; auf S. 96 zitiert BÖHME für di Schlangen-Prozession von Cucullo, BRUNO 1971, der seinem Aufsatz den folgenden bezeichnenden Titel gegegen hat: "Il serpente nel folklore e nelle usanze magiche e religiose della Marsica"; vergleiche S. 94, Abb. 6, zu dem auf diesem Dia rechts gezeigten Bild.
56 vergleiche W. BÖHME, N.N. ŠČERBAK 1993, 393: "Hier sei erwähnt, daß VEITH (1991*) der Vierstreifennatter ausgezeichnete Schwimmfähigkeit bescheinigt".
Ich habe diese beiden Vierstreifennattern im Juli 1965 im Meer bei La Masia in der Nähe von Cambrils (Katalonien) gesehen; auf Grund des auffälligen Zeichnungsmusters der Schlangen, ihrer Größen und ihres Verhaltens bin ich sicher, dass es sich bei diesen Tieren um Vierstreifennattern gehandelt hat. Vergleiche die Verbreitungskarte für diese Schlangenart bei W. BÖHME, N.N. ŠČERBAK 1993, 377, Abb. 71: Spanien ist darauf nicht verzeichnet.
Wolfgang Böhme, dem ich eine frühere Fassung meines Textes geschickt hatte, antwortete mir darauf per Email vom 15. März 2019:
"1. Ihre Beobachtung schwimmender Vierstreifennattern im Meer ist außerordentlich ungewöhnlich. Sie schreiben zu Recht, dass ich Spanien für diese Art nicht mit in die Verbreitungskarte einbezogen habe, denn es gibt sie dort ganz sicher nicht! Allerdings lebt dort eine bis nach Frankreich hinein verbreitete weitere Kletternatternart, die Treppennatter, Rhinechis (früher ebenfalls Elaphe) scalaris. Die erwachsenen, ebenfalls recht groß werdenden Schlangen haben wie die Vierstreifennattern ein Muster aus mehreren dünnen Längsstreifen, und auch professionelle Herpetologen haben beide Arten bereits verwechselt. Allerdings sind beide Arten Bewohner trockener Habitate und gehen normalerweise nicht ins Wasser zum Schwimmen, nicht einmal ins Süßwasser, und schon gar nicht ins Meer - soweit es uns bekannt ist. Wer dagegen tatsächlich aquatisch angepasst ist und auch eine stattliche Größe erreicht, ist die Iberische Ringelnatter, Natrix astreptophora, die tatsächlich auch mal in küstennahes Brack- oder Salzwasser eindringen kann. Sie ist aber eher einfarbig oliv-grau, klein gepunktet und immer ungestreift. Dann gibt es noch die sogen.[annte] Vipernatter, Natrix maura, die ebenfalls aquatisch lebt, aber viel kleiner bleibt. Soviel also zu den schwimmenden Schlangen im Meer. Nachfrage: Wo in Spanien war das? Mittelmeer- oder Atlantikküste?". - Im Mittelmeer, siehe oben.
57 vergleiche W. BÖHME 1993, passim; S. 338: "Die - aufgrund der dänischen, polnischen etc. Randisolate [das heißt, dieser Schlangenart] - bereits von BOULENGER (1913) zu Recht verworfene Hypothese, die westdeutschen Reliktvorkommen im Rheingautaunus und Odenwald seien auf Importe der Römer im Zusammenhang mit dem Asklepioskult zurückzuführen, wurde neuerdings auch mittels eines sehr interessanten altphilologisch-kunsthistorischen Ansatzes widerlegt (BODSON 1981)...".
W. BÖHME 2015, 93, nach einer Zusammenfassung der diesbezüglichen Forschungen, aus denen hervorgeht, dass die im Gebiet des ehemaligen Germanien angetroffenen Exemplare der Äskulapnatter nicht mit der Schlange des Asklepios identifiziert werden können, schreibt er auf S. 93-94 (im Kapitel: "Zur Identität der Schlange des Asklepios"):
"Wenn die im Mittelmeergebiet weit verbreitete, bei uns dagegen sehr seltene Äskulapnatter also in Germanien nicht die Schlange des AESCULAPIUS war, war sie es dann trotzdem im antiken Italien und Griechenland? Dagegen sprechen folgende Gründe:
Zum einen ihr Temperament: Schon, wenn man sie fängt, beißt sie wild um sich und wird auch nach längerer Haltung im Terrarium nie richtig zahm. Es gibt aber antike Quellen, die die Schlange des ASKLEPIOS als ausgesprochen friedlich charakterisieren, doch passt diese Eigenschaft perfekt auf die noch etwas größere, bis an die zweieinhalb Meter lang werdende Verwandte unserer Äskulapnatter, nämlich die in Italien und auf dem Balkan heimische Vierstreifennatter (Elaphe quatuorlineata) (WERNER 1938, BUCHHOLZ 1955, BÖHME 1993, und Abb. 6 [= hier Dia 17, rechts]), wie die belgische Altertumswissenschaftlerin LILIANE BODSON (1981) erstmals wahrscheinlich machen konnte (Vgl. dazu auch BODSON 2001). Zwar schrieb man damals der Schlange des ASKLEPIOS/ AESCULAPIUS auch eine besondere Vorliebe für Vogeleier zu, und in der Tat gehören Vögel und deren Eier zum natürlichen Nahrungsspektrum beider Arten, die beide auch gute Kletterer sind und daher Höhlenbrüternester leicht ausbeuten können. Doch zeigen die detaillierten Aufstellungen von Mageninhaltsanalysen an beiden Arten (vgl. BÖHME 1993), dass der Vogel- und Vogeleieranteil am Beutespektrum bei der Vierstreifennatter bedeutend höher ist als bei der ebenfalls gut kletternden Verwandten. Dazu passt, dass gerade sie, wiederum im Gegensatz zur Äskulapnatter, nach vorn gerichtete untere Fortsätze an den Halswirbeln besitzt, mit denen Vogeleier beim Verschlingen im Schlund aufgeschlitzt werden können (SZYNDLAR 1984, 1991), also ein wichtiges anatomisches Anpassungsmerkmal an Oophagie, welches der Äskulapnatter fehlt.
Dies legt zusätzlich nahe, dass es, wie von BODSON (1981, 2001) schon schlüssig dargelegt, vor allem die Vierstreifen- und weit weniger die Äskulapnatter ist, die sich als Begleiterin des ASKLEPIOS/ AESCULAPIUS um seinen Stab windet, auf den er sich in zahlreichen Skulptur-Darstellungen stützt ... Demzufolge war sie es auch, die in den Asklepios-Heiligtümern gehalten wurde. Sie von dort nach Rom zu verbringen, wie von PLINIUS und auch von dem Schriftsteller Valerius Maximus berichtet, war eigentlich nicht nötig, da sie in weiten Bereichen Italiens von Natur aus vorkommt, vermutlich war mit dieser Überlieferung auch eher der Transfer des Kultes gemeint als der lebendiger Schlangenindividuen [Hervorhebung von mir]".
Vergleiche zum Transfer des Asklepioskultes von Epidauros nach Rom im Jahre 291 v. Chr., Filippo Coarelli ("Navalia", in: LTUR III [1996] 339, Fig. 64 [= hier Dia 17.1]). Anlaß hierzu hatte eine Epidemie in Rom gegeben. Daraufhin war eine Gesandtschaft von Rom nach Delphi, zum dortigen Apollonorakel, geschickt worden. Auf Grund der Antwort der Priesterin Pythia in Delphi wandten sich die Römer dann nach Epidaurus, um im dortigen Asklepiosheiligtum um Hilfe zu bitten. Die Römer erhielten von den Priestern des Asklepios in Epidauros eine Asklepiosschlange (das heißt, nach der Vorstellung der Griechen und Römer, den Gott Asklepios selbst, siehe dazu oben, Anm. 39). Den Einzug der Asklepiosschlange in Rom - und zwar auf die Tiberinsel - zeigt eine Goldmünze des Kaisers Antoninus Pius [vergleiche hier Dia 17.1]. Seither werden - ununterbrochen - auf der Tiberinsel Kranke versorgt (das heutige Krankenhaus hat den wunderschönen Namen: "Fate bene fratelli", `tut Gutes, Brüder´).
Wolfgang Böhme (2015, 93) hat mit seiner oben zitierten Annahme aber sicher Recht: die Asklepiosschlange, welche die Römer mit einem Kriegsschiff aus Epidauros nach Rom geholt haben, ist sicher auch von mindestens einem Asklepiospriester begleitet worden, da ja in Rom unmittelbar danach der Kult des Aesculapius begonnen hat.
58 siehe oben, Anm. 57.
59 vergleiche zu Giftschlangen, O. KELLER 1913; vergleiche KELLER 1963. Auf S. 292 erwähnt er: ".. sie waren bunt ..., nicht schwarz wie die gefürchteten kurzen Nattern in Italien [mit Anm. 251, mit Nennung von antiken Schriftquellen]"; S. 295 zu einer in Griechenland vorkommenden Giftschlange; S. 297 zu der in Griechenland verbreitetsten Giftschlange, der südeuropäischen Sandviper, Vipera ammodytes. Nach O. KELLER 1913; vergleiche KELLER 1963, 301, haben die bis 1,50 m langen Seeschlangen, die ausschließlich im indischen Ozean leben, "Plattschwänze zum Rudern".
60 vergleiche G. LAHUSEN 1999, 301; S. MUTH, R.F. SPORLEDER 2017, 53; A. HENNING 2017, 418.
61 W. BÖHME, C. DE HAAN 2002, 47, das zweite Zitat stammt von S. 51, vergleiche passim; vergleiche ihre Abb. 37 auf S. 49: "Rechte Seitenansicht der Schlangenbronze aus Volubilis im Archäologischen Museum von Rabat".
62 Siehe B.S. RIDGWAY 2001, 569: "... (the male Porkis and the female Chariboia, as named in Sophokles' tragedy) would have been painted in different patterns"; vergleiche A. GEYER 1991, 61; und A. HENNING 2017, 418.
63 F. BREIN 1978, 37-38: "Nach Rom sind, soweit wir informiert sind, nur indische Riesenschlangen gelangt, also wohl P.[ython] molurus molurus. Augustus stellte in Rom eine aus, eine andere wurde ihm von Porus aus Indien geschickt, eine weitere erhielt Hadrian", mit Anm. 39 (antike Textstellen und Sekundärliteratur).
Vergleiche C. HÄUBER 2014, 613 mit Anm. 15 [für die Datierung der Laokoongruppe], 16; S. 621 mit Anm. 104-106, S. 620, zu "(3)"; S. 623 mit Anm. 124: Vorschlag, die Laokoongruppe sei geschaffen wurde, bevor Vergil seine Aeneis schrieb (das heißt, 38-30 v. Chr.), mit folgender Begründung, S. 623: "If it were created after 30 BC, we would then be forced to imagine that Maecenas or Octavian commissioned a Laocoon that contradicted Virgil's version of the story, a rather unlikely scenario" (darauf werde ich später noch einmal zurückkommen; siehe unten, zu Dia 48).
64 das hier nicht wörtlich wiedergegebene Zitat stammt aus G. LAHUSEN 1999, 300. Im speziellen Fall der Laokoongruppe, spricht R. WÜNSCHE 1995, 47 Anm. 62, treffend von ">Greuelästhetik<", und L. GIULIANI 2017, 272, gar von "einer Schönheit des Grauens". -
Für ihre Korrektur meiner (fehlerhaften) Wiedergabe dieser englischen Redensart bin ich meiner Freundin Frau Prof. Rose Mary Sheldon zu herzlichem Dank verpflichtet.
65 am 26. April 2018.
66 vergleiche F. MAGI 1960, 6-11, Fig. 1, S. 21-22 "5. Pezzo del braccio destro del Padre (tavv. XXVI e XXVII, I-3)"; S. MUTH, R.F. SPORLEDER 2017, 50; L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 291, "Abb. 1A-B Fragment des rechten Laokoon-Armes (Gipsabguss)"; S. 300, "Abb. 14A-H rechtes Armfragment des Laokoon (Digitales Modell)".
67 vergleiche L. POLLAK 1905, 278: "Den Arm, den Tafel VIII in zwei Ansichten, von vorn und rückwärts, zeigt [= hier Dia 22], fand ich bei einem kleinen römischen scalpellino unter allerlei alten Marmorfragmenten. Diese Leute kaufen gewöhnlich solche Fragmente an um sie dann zu verarbeiten. Der Arm war ihm als eben gefunden von der `via Labicana´ ohne nähere Provenienzangabe zugetragen worden [Hervorhebung von mir]".
Bezüglich der Frage, dass es sich beim `Pollakschen Arm´ um einen oder um den `Jahrhundertfund´ handelt, kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein.
Eugenio La Rocca und Pilar León 2008, 10, haben Walter Trillmichs Rekonstruktion der Aeneas-Askanios/Iulus-Anchises-Gruppe in Merida als eine der bedeutendsten Erkenntnisse "degli ultimi decenni" (`der letzten Jahrzehnte´) bezeichnet, und ich selbst habe 2015, 5, die von Lucos Cozza angefertigte `Kartierung´ der Marmorplatten des severischen Marmorplans auf jener Wand in einer Aula des Templum Pacis, an der diese größte Romkarte aller Zeiten einst befestigt war, als sehr bedeutende Leistung charakterisiert.
In unserem gemeinsamen Buch, habe ich einen Vorschlag gemacht, wo `an der Via Labicana´ der `rechte Pollaksche Arm´ des Laokoon gefunden worden sein könnte, und zwar, zusammen mit zahlreichen anderen antiken Skulpturen und Fragmenten von Skulpturen, in der ehemaligen Vigna Reinach; vergleiche C. HÄUBER, F.X. SCHÜTZ 2004, 133-134: "Die >Statuenmauern< an der modernen Via Labicana (vergleiche hier Abb. II.25; II.26, "Vigna Reinach"; STATUES")"; vergleiche C. HÄUBER 2014, 621 mit Anm. 108, 109 [zur Fundnotiz iin den NSc 1887, 140]). - Siehe unten, Kapitel IV.2.6, Punkt 4.), für meinen neuen Vorschlag zur Herkunft des rechten Arms des Laokoon.
Vergleiche F. BECKER, S. VOGT 2017, 171-173: "1903: Die Entdeckung des Laokoon-Armes durch Ludwig Pollak"; dieser hatte den Arm bereits 1903 entdeckt; S. 172: "Etwa ein Jahr später, am 7. März 1904, übergab Pollak das Armfragment an die Vatikanischen Museen"; S. 172 mit Anm. 8: "Daher sind die genauen Umstände der eigentlichen Entdeckung des Laokoon-Armes, bevor Pollak ihn in der Werkstatt sah, bis heute unbekannt".
Ich selbst bleibe (siehe oben) der Ansicht, dass der `Pollaksche Arm´ aus einer Ausgrabung oder aus einem anderen Bodenaushub stammen muss, welcher kurze Zeit zuvor an der Via Labicana stattgefunden hatte, wie POLLAK, op.cit., selbst schrieb. Weshalb ich, mangels anderer bekannter archäologischer Ausgrabungen im fraglichen Zeitraum an der Via Labicana, meinen diesbezüglichen Vorschlag nach wie vor für plausibel halte.
Das Zitat bezüglich der auf Dia 22 gezeigten Rekonstruktionszeichnung, die Pollak von dem Zeichner Ernst Sopp anfertigen ließ, stammt aus L. POLLAK 1905, 281.
Vergleiche P. LIVERANI 2006, 31 Anm. 25, S. 39 mit Anm. 70: "A distanza di quattro secoli dal suo rinvenimento, il Laocoonte aveva in serbo ancora un'ultima sorpresa. Ludwig Pollak, una figura che univa in sé in modo del tutto perticolare lo studioso, il mercante d'arte e il connaisseur, aveva pubblicato [mit Anm. 70, mit Angabe von Literatur] e donato al museo un braccio piegato e parzialmente avvolto nelle spire di un serpente [cfr. cat. 90].
L'aveva riconosciuto nella bottega di un scalpellino il quale l'avrebbe ritrovato in uno scavo lungo il tratto urbano della via Labicana, dunque non troppo distante dal luogo del rinvenimento cinquecentesco del gruppo scultoreo"; vergleiche S. 192, Kat. "90 Braccio Pollak 40-20 a.C. marmo di Paros (?) Da Roma, rinvenuto nella bottega di un scalpellino nei pressi della via Labicana (1905) Musei Vaticani, inv. 1064".
Vergleiche zum `Pollakschen Arm´ auch F. MAGI 1960, 6 mit Anm. 5, "Fig. I - Prima prova di rimessa a posto del braccio Pollak", S. 21-22: "5. Pezzo del Braccio destro del Padre (tavv. XXVI e XXVII, I-3)", S. 23.
68 F. BECKER, S. VOGT 2017, 175, vergleiche S. 174-175: "Die Rekonstruktion durch Georg Treu (1906)"; S. 174, "Abb. 3A-B Rekonstruktion der Statuengruppe in Gips nach Georg Treu, A: Vorderseite, B: Rückseite mit Verlauf der oberen Schlange". Die Autorinnen zitieren für ihre Diskussion der Rekonstruktion Georg Treus unter anderem I. RAUMSCHÜSSEL 1994. Vergleiche S. MUTH 2017b, 51: "Erste Rekonstruktion im Gipsabguss unter Einbindung des >Pollakschen Armes< durch Georg Treu [mit einer Abbildung dieser Rekonstruktion]; L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 291 mit Anm. 3; vergleiche S. 320, "Abb. 41 Rekonstruktionsvorschlag der Laokoongruppe von Georg Treu (1906/07)".
69 vergleiche E. VERGARA CAFFARELLI 1954, vergleiche F. MAGI 1960, 6 mit Anm. 4; vergleiche hier Dia 29; siehe unten, zu Anm. 108. Vergleiche P. LIVERANI 2006, 39 mit Anm. 71; F. BECKER, S. VOGT 2017, 175-176: "Rekonstruktion durch Ernesto Vergara Caffarelli (1942-54)"; S. 176 zu dem `Zwischenstück´ an Laokoons rechter Schulter, das von dem Bildhauer Lorenzo Ferri angefertigt worden ist.
70 siehe hier Dias 23; 24.
71 vergleiche P. LIVERANI 2006, 38, mit Anm. 55 (vergleiche Kat. 77) -Anm. 57 (vergleiche Kat. 40). Diese Partie von Laokoons rechter Schulter wurde für den folgenden restaurierten rechten Arm Laokoons abgetragen, der niemals dem Laokoon angefügt worden ist: S. 180-181, Kat. "77 Anonimo Braccio destro sbozzato per un restauro del Laocoonte Seconda metà del XVI secolo o inizi del XVIII secolo marmo bianco Musei Vaticani, inv. 1067" (P. LIVERANI); vergleiche S. 150-151, Kat. 40, der Bronzeabguß der Laokoongruppe von Francesco Primaticcio. Vergleiche hier Anm. 77.
72 P. LIVERANI 2006, 39.
73 siehe hier Dia 21.
74 siehe hier Dias 23; 24.
75 vergleiche F. MAGI 1960, 11. Wie Claudia Valeri mir freundlicherweise anläßlich unserer Diskussion vor der Laokoongruppe am 16. April 2018 erzählte, hatte Filippo Magi bei seiner Restaurierung der Gruppe überdies den Bildhauer Giovanni Mecco als Berater hinzugezogen.
76 Vergleiche zu Pollak jetzt, O. ROSSINI 2018a; Vgl. die beiden Tafeln nach S. 11: "Il gruppo del Laocoonte prima e dopo la restituzione del >>Braccio Pollak<<". Ich danke Franz Xaver Schütz für den Hinweis auf diese Ausstellung, und Sylvia Diebner für den Hinweis auf diesen Katalog.
Das Zitat ist aus O. ROSSINI 2018b, pp. -22-24, mit Anm. 22-24.
Vergleiche Anm. 22: "Stamane ho portato il braccio destro del Laocoonte in Vaticano. I custodi rimanevano non poco stupefatti. Il braccio sembra essere una replica" (Diari, XIV,17).
Vergleiche Anm. 23: Hier fasst O. ROSSINI die Geschichte der Anpassung des `Pollakschen Arms´ zusammen, mit den damit zusammenhängenden Schwierigkeiten, die ich oben ebenfalls geschildert habe, und zitiert für die Geschichte der Restaurierung der Laokoongruppe, F. BURANELLI et al. 2006.
Vergleiche Anm. 24: "Museo Barracco, Archivio Pollak 47.6.0.
77 vergleiche F. MAGI 1960, 11 mit Fig. 8; S. 47-50, Tav. VI-VIII; F. BURANELLI et al. 2006, 150-151, cat. "40 Francesco Primaticcio (Bologna 1504-Paris 1570); e collaboratori Laocoonte e i suoi figli, replica dall'antico 1543 ... (AL [diese Initialen erscheinen nicht in der Liste der Autoren der "Schede" = der Katalogbeiträge])".
Vergleiche zu Francesco Primaticcios Bronzeabguss des Laokoon auch S. MUTH, R.F. SPORLEDER 2017, 48; L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 133-134; S. 151 Abb. 28, S. 154-155, Abb. 32A-B; S. 154-155: "2.3.3 Der bossierte Arm", S. 155-158: "Die (Re-)Konstruktion des Laokoon im 16. Jahrhundert: Ein dynamischer Prozeß", mit Abb. 33-36; S. 156: "Abb. 33 Sogenannter bossierter Arm, Marmorarm des 16. oder 18. Jahrhunderts, Anbringung an die Laokoonstatue nie realisiert; Vatikanische Museen"; vergleiche auf S. 156 ihre "Abb. 34 Vorrichtung an der rechten Schulter der Laokoonstatue zum Einsatz des bossierten Armes (Digitaler Scan)"; vergleiche S. 296, "Abb. 9A-B Bronzeabguss des Primaticcio: erhaltene antike Anstückungsfläche an der rechten Schulter mit Spuren von antiken Dübellöchern"; vergleiche R.F. SPORLEDER 2017, 163, Abb. 5: "Der sog.[enannte] bossierte Arm, an den Laokoon-Torso durch Filippo Magi 1957-60 angesetzt [es handelt sich um die Aufnahme F. MAGI 1960, Tav. XLIX, I]"; vergleiche S. 164. Vergleiche zum `bossierten Arm´, auch F. MAGI 1960, 11, 12, Abb. 9, S. 46-50: "Cap. VII - Il braccio restaurato da Michelangelo" (womit MAGI den sogenannten bossierten Arm meinte), Tav. XLIX I-4. Vergleiche zu Francesco Primaticcios Bronzeabguss des Laokoon ferner, F. SLIWKA 2017, 188, Abb. 2, S. 189.
78 vergleiche F. MAGI 1960, 6: "Quanto al braccio Pollak, che era stato il movente dell'operazione, si poteva subito constatare che esso effettivamente aveva appartenuto alla statua. Infatti sulla spalla, tra altri fori per perni, se ne scopriva uno per perno di ferro che risultava in asse con quello esistente nel braccio medesimo nel taglio sotto al deltoide. Scoperta, questa di prim'ordine, come ognun vede, che ci indusse a fare immediatamente una prova di rimessa in posto [vergleiche seine Fig. 1 auf S. 7: "Prima prova a posto del braccio Pollak" (Hervorhebung von mir)]; vergleiche S 15, zu seiner Tav. XXIII und XXIV, I, mit weiteren Beobachtungen am Original, welche diese erste Annahme zweifelsfrei bestätigt haben, sowie entsprechenden Beobachtungen an Primaticcios Bronzeabguss.
79 P. LIVERANI 2006, 38 mit Anm. 56, 60, 61 (mit Angabe von Literatur). So auch F. MAGI 1960, 23 mit Anm. 23.
80 vergleiche F. MAGI 1960, 28 mit Anm. 16 (wörtlich zitiert unten zu Anm. 108).
81 vergleiche S. Muth 217a, 471. Selbstverständlich hatte bereits MAGI 1960, 14, Fig. 10, Tav. XX, I-2; Tav. XXI, I-2, der diesen Gipsabguss ja hatte anfertigen lassen, ihn auch selbst von allen Seiten abgebildet. Leider ist jedoch auf seinen Illustrationen die Bosse an Laokoons linker Hüfte nicht gut erkennbar.
82 vergleiche F. MAGI 1960, 28 mit Anm. 16 (wörtlich zitiert unten zu Anm. 108).
83 vergleiche für entsprechende Beschreibungen zum Beispiel F. MAGI 1960, 30-31; S. MUTH 2017b, 37; und B.S RIDGWAY 2018, 258 (zitiert oben, als Motto des Kapitels Einführung). Vergleiche zur besonderen Betonung des Leidens der Protagonisten der Laokoongruppe, auch S. MUTH 2017b, 35-36 (wörtlich zitiert unten, in Anm. 103).
Vergleiche die kolorierte Fassung der neuen Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe: S. MUTH 2017a, Taf. 24.
Der Kunsthistoriker Prof. Dirk Kocks hat den David des Donatello im Sommersemester 1976 in seinem Proseminar "Italienische Plastik des Quattrocento" an der Universität zu Köln vorgestellt, an dem ich teilgenommen habe.
Das wörtliche Zitat aus Sir Kenneth Clark (1976, 49, zu seiner Abb. "38. DONATELLO. David) lautet: "But these obvious sources of inspiration do not prevent the David from being a work of almost incredible originality, which nothing else in the art of the time leads us to anticipate ... It is curiously different, even, from he rest of Donatello's work, in which he appears as the sculptor of drama, and of man's moral and emotional predicament, and not of physical perfection. Yet we feel that in the David he has looked as eagerly as a Greek of the 4th century at those tensions and transitions which make the youthful body sensuously appealing ... [Hervorhebung von mir]".
Vergleiche zum Motiv des Gewandes des Knaben (hier Dia 27), das eine Schulter entblößt, und das an antike Darstellungen der Aphrodite und ihr angeglichene Frauen, besonders Bräute, erinnert, C. HÄUBER (2014, 570 mit Anm. 12, mit ausführlicher Diskussion der Ikonographie von Bräuten).
Jürgen Müllers Aufsatz (2017) stellt meiner Meinung nach eine erstklassige Studie zu Caravaggios Gemälde `Junge von einer Eidechse gebissen´ (hier Dia 27) dar, da er für die einzelnen ikonographischen Details des Bildes sehr präzise Vergleiche bietet. Nur in einem Punkt (Seite 200) ist sein Text nicht (ganz) korrekt: Hier nennt der den von Caravaggio portraitierten Knaben einen "Jüngling". Johanna Fabricius (2000, 39 mit Anm 1; vergleiche C. HÄUBER 2014, 766 Anm. 210) hat die Bedeutung des Begriffs "Jüngling", der auch in der archäologischen Fachliteratur unreflektiert auf `junge Männer´ der antiken Kulturen angewandt wird, genau untersucht. Und, da er in der Epoche seines Aufkommens und seiner berechtigten Geltung eine ganz besondere Bedeutung gehabt hat, die auf keinen einzigen jener jungen Männer anderer Epochen zutrifft, die gemeinhin in der archäologischen Fachliteratur ebenfalls als `Jünglinge´ apostrophiert werden (und ebensowenig auf den Knaben auf Caravaggios Gemälde, vergleiche hier Dia 27), schließe ich mich der Meinung von Fabricius an, dass man den Begriff `Jüngling´ nicht als Bezeichnung für `junge Männer´ ganz anderer Epochen verwenden sollte.
84 vergleiche L. GIULIANI 2017, passim.
85 vergleiche zu ihm, C. HÄUBER 2015, 3 mit Anm. 7; und C. HÄUBER 2024. Ich habe vom Wintersemester 1969 bis Sommersemester 1972 an der Universität Duisburg im Kunstseminar bei dem Bildhauer Kurt Sandweg Bildhauerei, Freihandzeichnen und Aktzeichnen studiert und bei ihm und im Kunstseminar im Oktober 1972, unmittelbar nach der Romexkursion im September, das 1. Staatsexamen (Gesamtnote des Staatsexamens "Mit Auszeichnung") absolviert. Herr Sandweg unterhielt ein großes Bildhaueratelier in Düsseldorf-Wittlaer, `Froschenteich´. Dort war ich bei ihm im gleichen Zeitraum als Assistentin beschäftigt. Nach dem Staatsexamen bin ich dann zum Zweitstudium an die Universität zu Köln gewechselt, um Klassische Archäologie, Kunstgeschichte und Alte Geschichte zu studieren.
86 die hier gezeigten Aufnahmen der Laokoongruppe zeigen zum einen, dass die Gruppe sehr `photogen´ ist (vergleiche hier Dia 10, eine Aufnahme von Giovanni Ricci Novara, in der Laokoons Torso geradezu wie das Aktphoto eines Mannes in der Art von Magazinphotographie wirkt), und zum anderen, dass die Aufnahmen von Laokoons Gesicht der verschiedenen Photographen so verschieden sind, dass man daran zweifeln könnte, dass es sich um ein und dasselbe Stück handelt (vergleiche hier Dia 8, die Aufnahme von Giovanni Ricci Novara und Dia 36, rechts, ein Museumsphoto, einerseits, die beide die `Schönheit im Leiden´ von Laokoons Gesicht unterstreichen, mit Dia 37 andererseits, einer Aufnahme von Amanda Claridge, auf der in Laokoons Gesicht von Schönheit rein gar nichts zu finden ist. - Mir kommt das auf diese Weise charakterisierte Gesicht des Laokoon so vor als handele sich um den Waldgeist des Riesengebirges mit dem schönen Namen `Rübezahl´, mit dem man mir Angst eingejagt hat als ich ein kleines Mädchen war.
Für das Photo von Amanda Claridge wurde das Gesicht Laokoons mit einer Lampe beleuchtet, weil ich, als sie diese Aufnahme gemacht hat, gleichzeitig, und neben ihr vor dem Original stehend, die auf dem Dia 37, im Kasten oben rechts, wiedergegebene Skizze angefertigt habe. Möglich war das nur während der Laokoon-Ausstellung in den Vatikanischen Museen 2006-2007 (vergleiche F. BURANELLI et al. 2006), als sich die Laokoongruppe nicht an ihrem angestammten Standort, sondern in den Räumen dieser Ausstellung befand. Giandomenico Spinola hatte, auf meinen Wunsch hin, ein entsprechendes Gerüst vor der Laokoongruppe errichten lassen, auf dem dann Amanda Claridge und ich am 15. Februar 2007 gleichzeitig und nebeneinander agieren konnten; vergleiche C. HÄUBER 2014, 619 Anm. 87.
Zur `Power of Placement´, auch bezogen auf die Laokoongruppe, die seit ihrer Entdeckung im Jahre 1506 ja sehr viele, gut dokumentierte Aufstellungssituationen erlebt hat, siehe V. NEWHOUSE 2005, 299 Index s.v. Laocoön; sowie F. BURANELLI et al. 2006; und S. MUTH 2017a, beide passim. Vergleiche für einen Versuch, die originale Installation der Laokoongruppe und ihrer originalen Beleuchtung zu visualisieren, S. MUTH 2017a, 335-337, "Abb. 3 Digitale Rekonstruktion der Laokoongruppe, Wahrnehmung bei künstlicher Beleuchtung (Feuerschein)"; S. 372, "Abb. 18 Rekonstruktionsvorschlag zur Wahrnehmung der Laokoongruppe unter den Bedingungen antiker Beleuchtung"; sowie "Taf. 25B Digitales Laokoon-Modell Rekonstruktionsvorschlag zur möglichen Wahrnehmung der Statuengruppe unter antiken Beleuchtungsbedingungen (Feuerschein)".
87 vom 16. Dezember 2010 bis 30. September 2021 war ich im Department für Geographie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München beschäftigt, an der Lehr- und Forschungseinheit Wirtschaftsgeographie und Tourismusforschung von Prof. Dr. Jürgen Schmude und Prof. Gordon M. Winder, wo unter anderem auch derartige Phänomene des Tourismus wissenschaftlich untersucht werden.
88 vergleiche S. Muth 2017a, Taf. 11. Wie erwähnt, hatte Magi diesen Gipsabguss im Laufe seiner Restaurierung anfertigen lassen; cf. P. LIVERANI 2006, 39. Vergleiche die Aufnahmen dieses Gipsabgusses in F. MAGI 1960, Tav. XX; XXI. Vergleiche zu diesem Gipsabguss auch W. FILSER 2017, 375; S. MUTH, D. MARIASCHK, H. VOGLER 2017, 471.
F. MAGI 1960, 11, beschreibt seine Rekonstruktion des Schwanzes der `oberen´ Schlange, welcher dem Laokoon auf den Rücken fällt; vergleiche seine Tav. XLVII, I-2: "Il Laocoonte di dorso, ripristinato, e ripristinato e integrato"; ich meine die Aufnahme Tav. XLVII, 2. Magis Rekonstruktionsvorschlag des Schwanzes der `oberen´ Schlange ist auch abgebildet in: F. BECKER, S. VOGT 2017, 179, Abb. 10A-B Rekonstruktion der Statuengruppe in Gips nach Filippo Magi, A. Vorderseite, B. Rückseite".
Im Gegensatz dazu, wird in der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe der Schwanz der `oberen´ Schlange am erhobenen rechten Arm des jüngeren Sohnes angenommen; vergleiche L. GIULIANI, S: MUTH 2017, 320-323: "Ein Rekonstruktionsvorschlag: Wo endet der Schlangenschwanz? Vergleiche S. MUTH 2017b, 357: "7) Antikes Teilstück I (Abb. 9A-F): Block mit rechtem Arm und Kalotte des jüngeren Sohnes sowie dem diese beiden verbindenden Teil der oberen Schlange, die vom Rücken des Laokoon nach vorne zieht ... Dieses Teilstück ist komplett verloren und kann lediglich aus den erhaltenen Spuren am Statuenbefund ansatzweise rekonstruiert werden. Das hier vorgeschlagene und abgebildete Aussehen dieses einstigen Teilstückes basiert auf der Gesamtrekonstruktion der Statuengruppe (Essay 20) und versteht sich lediglich als eine Annäherung an ein mögliches Aussehen des Teilstücks". Vergleiche zu diesem Essay 20 von L. GIULIANI, S. MUTH 2017 die in dieser Anm. oben bereits zitierten Passagen, sowie unten, Anm. 100, 102.
89 das sieht man auch auf der Abbildung bei F. MAGI 1960, Tav. XLVII, I; und bei S. Muth 2017a auf Taf. 23 (= hier Dia 32). Die hier besprochene Bosse auf Laokoons Rücken diskutieren L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 307, 310.
Ich danke Herrn Prof. Ralf Krumeich sehr herzlich, der den hier angesprochenen Punkt nach meinem Vortrag mit mir diskutiert hat, da, seiner Ansicht nach, die an der `oberen´ Schlange auf Laokoons Rücken beobachtete Verjüngung eine wichtige Bestätigung meiner Hypothese darstelle. Und Herr Prof. Ritter war so freundlich, mich nach meinem Vortrag nach den Gründen zu fragen, welche die Autoren der neuen Berliner Rekonstruktion (vergleiche S. MUTH 2017a) im Einzelnen dazu bewogen haben, den Kopf der `oberen´ Schlange nicht mehr an der linken Hüfte Laokoons anzunehmen. Diese Gespräche mit beiden Herren zum Anlass nehmend, habe ich diese meine hier gemachte Behauptung im Folgenden ausführlicher begründet, als dies bereits in meinem Vortrag geschehen war, indem ich meinen Text entsprechend erweitert habe. Außerdem wurden dem Text Anmerkungen hinzugefügt, in denen die jeweiligen Autoren wörtlich zitiert werden. Wie wir gleich sehen werden, hängen die von Krumeich und Ritter angesprochenen Fragestellungen auch eng zusammen, da es sich in beiden Fällen um Teile derselben, nämlich der `oberen´ Schlange handelt.
90 vergleiche für den `Pollakschen Arm´ L. POLLAK 1905, Abb. 1; 2; F. MAGI 1960, 6-15, Tav. XXVI; XXVII, I-3; F. BECKER, S. VOGT 2017, 172, Abb. 1A-C; L. GIULIANI, S. MUTH, 2017; 291, Abb. 1A-B; vergleiche S. 334 Abb. 3A-B, und oben zu Anm. 66-68.
91 L. GIULIANI, S. MUTH, 2017, 315, "Abb. 34 Die obere Schlange: Messung des Durchmessers des Schlangenkörpers bei dem rechten Arm und der linken Hand [originaler Befund und Befund der neuzeitlichen Abarbeitung] (Digitales Modell). Vergleiche auch die Rekonstruktion der Berliner Ausstellung von 2016-2018, in welcher die `obere´ rot und die `untere´ Schlange grün eingefärbt ist; vergleiche MUTH 2017a, Taf. 24: "Digitales Laokoon-Modell: Rekonstruktionsvorschlag einer möglichen kolorierten Fassung der antiken Statuengruppe".
92 die zuletzt gemachte Beobachtung habe ich, vor dem Original der Gruppe, am 8. März 2019, gemeinsam mit Giandomenico Spinola und Claudia Valeri, gemacht.
Vergleiche MAGI 1960, 16-17: "Altri due tagli di connessione si riscontrano nel tratto di serpente stretto dalla mano sinistra (tav. XXXI, I e 2 [die Bildunterschrift lautet: "Tagli di connessione del serpente sul braccio e alla mano sinistra del padre"]). L'uno di essi si trova di fianco alla mano stessa e ha la superficie piatta (forse leggermente rilavorata) con foro centrale circolare originale per perno (diam. cm. 1,5) e solco contiguo per la colatura del piombo. Il perno ritrovato è di rame e si è lasciato al suo posto. Tracce di rilavorazione mostrano che il [Seite 17] serpente, originariamente un poco più grosso, è stato in seguito leggermente diminuito per meglio adattarlo al suo proseguimento sull'altro pezzo. Altre tracce di rilavorazione si notano sul serpente nel tratto sottostante alle dita, là dove è anche caduta, forse a causa della medesima rilavorazione (che deve attribuirsi a restauro) la estremità del pollice. Il taglio netto del serpente dall'altra parte della mano è evidentemente moderno; il serpente infatti continuava integro fino alla testa che affondava i denti nel fianco di Laocoonte dove sono evidenti resti di attacco" [Hervorhebung von mir].
MAGI, op.cit., beginnt seine Beschreibung der "Altri due tagli di connessione" jenes Teilstücks der `oberen´ Schlange, welches Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, rechts von Laokoons linker Hand, wenn man diese von vorn betrachtet; vergleiche S. MUTH 2017a, Taf. 7b (= hier Dia 27). Zuvor hatte F. MAGI 1960, 16 mit Anm. 8, darauf hingewiesen, welche am Laokoon von ihm beschriebenen Brüche auf den Sturz auf dem Montecenisio zurückzuführen seien; in seiner Anm. 8 nennt er das Datum des Unfalls sowie Literatur; S. 17 (zum Bruch von Laokoons Hand anläßlich dieses Unfalls).
L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 149-150, mit Ann. 53, "Abb. 25A-C Überarbeitung der linken Hand des Laokoon und Reduktion des Schlangenkörpers (A-B: Originale Statue, C: Abguss)"; vergleiche S. 150, wo sie auf Essay 24 von W. FILSER 2017 im selben Band verweisen (siehe die im Folgenden in dieser Anm. zitierten Passagen); vergleiche S. 304: die linke Hand Laokoons "ist somit im Begriff, die Schlange nach unten zu schieben. Von dem Schlangenkörper, den die Hand gepackt hält, ist nur ein vergleichsweise kurzes Stück erhalten (Abb. 22A-B). An der Außenseite der Hand endet er sogleich mit einer antiken Anstückungsfläche - der hier ansetzende Teil ist verloren. An der zum Körper gewandten Innenseite biegt sich die Schlange in engem Bogen zurück zur Hand, also vom Körper des Laokoon weg, um hier ebenfalls mit einer Ansatzfläche zu enden: diese allerdings ist nicht antik, sondern modern [mit Anm. 30: "Magi 1960, 17"]".
Vergleiche L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 308, wo L. GIULIANI, S. MUTH 2017, auf ihrer Abb. 23, das eben genannte Teilstück der `oberen´ Schlange an Laokoons linker Hand von hinten gesehen abbilden; vergleiche S. 308, "Abb. 23 Die obere Schlange bei der linken Hand des Laokoon: Messung des Durchmessers des Schlangenkörpers; originaler Befund [auf der Zeichnung befindet sich links von Laokoons linker Hand die schwarze Beschriftung: "8,8 cm"] und Befund der neuzeitlichen Abarbeitung [auf der Zeichnung befindet sich links von Laokoons linker Hand die weiße Beschriftung: "7,0 cm"] (Digitales Model)". Ihre Abb. 23 zeigt die linke Hand Laokoons von hinten betrachtet, mit den beiden Enden des Teilstücks der `oberen´ Schlange, welche Laokoon ergreift. Die zitierten Durchmesserangaben beziehen sich auf den hier betrachteten Stumpf der `oberen´ Schlange, mit der von MAGI, op.cit., zuerst beschriebenen Anstückungsstelle. Diese Anstückungsstelle ist ganz rechts in Laokoons geballter linker Hand verborgen (wenn man die Gruppe von vorn betrachtet); sie ist auf der Vorderseite der Gruppe nicht sichtbar, aber auf der hier gezeigten Rückseite von Laokoons linker Hand. Vergleiche L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 309-310 mit Abb. 24 [= F. MAGI 1960, Tav. XXXI, 2] "Spuren der neuzeitlichen Abarbeitung bei der linken Hand des Laokoon und der Reduktion des Schlangenkörpers (originale Statue)".
MAGI, op.cit., sagt aber, im Gegensatz zu den hier aus den Bildunterschriften von GIULIANI, MUTH, op.cit., zitierten Behauptungen, dass auf dieser Seite des Teilstücks der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, der Durchmesser dieser Schlange bereits in der Antike - im Zuge der Montage von diesem Einzelteil der Gruppe mit dem Anschlußstück, abgearbeitet worden sei, "per meglio adattarlo [das heißt, diesen Teil des Körpers der oberen Schlange] al suo proseguimento sull'altro pezzo". Bei diesem "altro pezzo", auf dem sich der Körper der `oberen´ Schlange fortsetzte, handelt es, nach der Nomenklatur von S. MUTH 2017b, 356, um: "3) Teilstück C [= Kombination der 1506 gefundenen Teile C & G] (Abb. 5A-H): Block mit dem älteren Sohn ...".
Auf diese eben zitierten, falschen Behauptungen von GIULIANI, MUTH, op.cit., bezüglich der Verringerung des Durchmessers des Teilstücks der `oberen Schlange´, welches Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, werde ich unten in Anm. 100, sowie im Text zu Anm. 106, 107, noch einmal zurückkommen. Dagegen folgt W. FILSER 2017, dessen diesbezügliche Passagen ich im Folgenden zitiere, der Interpretation dieses Befundes durch L. GIULIANI, S. MUTH, op.cit.
Vergleiche W. FILSER 2017, 381-382: "Eine andere Lösung mussten die Bildhauer finden, um den älteren Sohn (Block C) über seinen Arm (G) mit dem linken Arm des Laokoon (Block A) zu verbinden; auch deshalb eine heikle Stelle, da sie durch den komplexen Verlauf der oberen Schlange, die sich hier in mehreren Windungen um die Glieder von Vater und Sohn legt, wesentlich beschwert [corr.: erschwert] wird (Abb. 11 ["Stück G (ursprünglich zu Block C gehörig). Modern überarbeitete Anstückungsflächen mit hypothetischer antiker Klammerung aus BRONZE" - Es handelt sich um eine Aufnahme nach dem Berliner digitalen Modell. Laokoons linke Hand ist von hinten gezeigt, die beiden von MAGI, op.cit., beschriebenen Ansatzflächen des Teilstücks der `oberen´ Schlange, das Laokoon mit seiner linken Hand ergreift, sind gut sichtbar]). Angesichts dieser selbstauferlegten Herausforderung entschied man sich wohl von Beginn an dafür, das Stück G auf der Rückseite an der Schlange oberhalb des Handgelenks des Laokoon zu verklammern, und zwar - darauf lassen die fehlenden Oxidationsspuren schließen - stets per Bronzeklammer (heute Kupfer) [mit Anm. 20; mit weiterer Diskussion]. Um eine solche einzusetzen, musste der Rückteil separat gearbeitet und verdübelt werden, worauf vielleicht noch drei entsprechende Löcher schließen lassen [Anm. 21; mit weiterer Diskussion]. Wie gefährdet dieser Bereich aufgrund seiner zwischen Vater und Sohn eingekeilten Lage war, ersieht man auch an den vielfach überarbeiteten Anstückungsflächen, die es schwer machen, Rückschlüsse auf ihre ursprüngliche Gestalt zu ziehen [mit Anm. 22; mit weiterer Diskussion]. Dass es auch in der Antike an dieser neuralgischen Stelle zu Beschädigungen kam, zeigt sich jedenfalls an dem ebenfalls neuzeitlich stark gestörten Befund der linken Hand [mit Anm. 23: "Die ganze Hand ist neuzeitlich per verbleitem Metalldübel angesetzt worden: Magi 1960, 17. Womöglich ist sie mit dem gesamten linken Oberschenkel des Laokoon, mit dem sie über einen puntello (s. Anm. u. [= Anm. 25]) verbunden war, beim Sturz auf dem Moncenisio abgebrochen; zum Vorschlag eines früheren und bewusst vorgenommenen Eingriffs, siehe hier Essay 6", - mit Hinweis auf L. GIULIANI, S. MUTH 2017 [siehe dazu unten, Anm. 100] des Laokoon, die mit G über ein angesetztes Schlangenstück per Eisendübel verbunden war (Abb. 12 ["Die Linke Hand des Laokoon (Original und digitales Modell)". - als `Original´ ist ein Ausschnitt aus F. MAGIs Tav. XXXI, 2 abgebildet] [mit Anm. 24; er zitiert "Magi 1960, 16", mit weiterem Kommentar]. Die neuzeitlichen Veränderungen zielten darauf, den Durchmesser der Schlange kontinuierlich in Richtung des Daumens, der dieser Aktion zum Opfer fiel, zu verringern, was plausibel damit in Verbindung gebracht werden kann, dass man die anschließende Form und Bewegung des Reptils veränderte", mit Anm. 25: "Magi 1960, 16f. Dabei musste man den kleinen puntello stehenlassen und als solchen sichtbar machen, während vormals der Daumen (und der Schlangenkörper?) die stabilisierende Verbindung zum Oberschenkel bildete. Zur rekonstruierten Bewegung der Schlange und der Frage nach der Lokalisierung ihres Kopfes, siehe Essay 20", womit er auf L. GIULIANI, S. MUTH 2017 verweist; die entsprechenden Passagen sind unten, zu Anm. 100, 103, zitiert.
Mit der Formulierung: "Il taglio netto del serpente dall'altra parte della mano è evidentemente moderno" meinte MAGI, op.cit., offenbar den glatten Schnitt durch den Körper der `oberen´ Schlange, der im rechten Winkel zur Körperachse der Schlange gelegt ist. Dieses Teilstück der `oberen´ Schlange ist links von Laokoons Hand sichtbar (wie Magi schreibt), wenn man die Hand von vorn betrachtet (vergleiche S. MUTH 2017a, Taf. 7b = hier Dia 27): Bis zu diesem glatten Schnitt reichte die Ergänzung des Kopfes der `oberen´ Schlange, mit dem anhaftenden Teil ihres Halses, die Agostino Cornacchini geschaffen hatte (für diese Ergänzung, siehe unten zu Anm. 98), weshalb aus diesem Faktum meines Erachtens gleichfalls geschlossen werden muss, dass bis zu diesem `glatten Schnitt´ durch den Hals der `oberen´ Schlange bereits der restaurierte Kopf der `oberen´ Schlange mit dem anhaftenden Halsstück gereicht hatte. Was wir an MAGIs Restaurierung von 1960 an dieser Stelle sehen, ist dagegen ein Gipsabguss von Cornacchinis Marmorergänzung; vgl. hier Dia 27 (siehe unten, Anm. 108).
Vergleiche für die separat skulptierten antiken Teilstücke, aus denen die Laokoongruppe zusammengesetzt worden ist, F. MAGI 1960, 13-23, "cap. II - I pezzi componenti il gruppo", mit Abb. 10-18, Taf. XX-XXXV.
Vergleiche L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 315, Abb. 34 und S. 308, "Abb. 24 Spuren der neuzeitlichen Abarbeitung bei der linken Hand des Laokoon und der Reduktion des Schlangenkörpers (originale Statue [hierbei handelt es sich um die Aufnahme bei F. MAGI 1960, Tav. XXXI, 2])", diskutiert auf S. 309-311; auf S. 309, Anm. 37, zitieren sie: MAGI 1960,17, 24.
Vergleiche S. MUTH 2017b, 356-357, für die Teilstücke 1)-7), das heißt, die Blöcke A-G, mit Abb. 3A-N - 9A-F, aus denen die Laokoongruppe zusammengesetzt worden ist; vergleiche ihre Abb. 1 auf S. 87, sowie das Frontispiz des Bandes, eine Aufnahme, auf der die Gipsabgüsse der originalen Teilstücke der Laokoongruppe nebeneinanderstehend wiedergegeben sind.
Um sich klarzumachen, wie die Blöcke A (Laokoon), C (älterer Sohn) und G (Schlangengewinde am rechten Arm des älteren Sohnes) aneinanderpassen, vergleiche F. MAGI 1960, 28, 38, zu Tav. XLI: "Il Laocoonte ripristinato" (= die Vorderseite der Gruppe); vergleiche S. 27, 28, 44, zu Tav. XLIV: "Il Laocoonte ripristinato e integrato" (= die Vorderseite der Gruppe, mit zum Teil inzwischen wieder abgenommenen Ergänzungen); vergleiche S. 28, 38, zu Tav. XLVII, I-2: "Il Laocoonte di dorso, ripristinato, e ripristinato e integrato".
Vergleiche S. MUTH 2017b, 38, "Abb. 22 Digitale Visualisierung der Laokoongruppe mit der Zusammenfügung ihrer überlieferten antiken Teilstücke", auf welcher diese Einzelblöcke in jeweils einiger Entfernung zueinander wiedergegeben sind, aber so, dass man sich vorstellen kann, wie sie zusammengehören. Das an Block A unmittelbar anschließende Teilstück der `oberen´ Schlange, das zu Block C gehört hatte (jetzt also zu Block G gehören müßte), ist offenbar verlorengegangen. Es ist in der Berliner Rekonstruktion ergänzt worden, vergleiche S. MUTH 2017b, 39, "Abb. 23 Digitale Visualisierung der Laokoongruppe in der Zusammenfügung ihrer rekonstruierten antiken Teilstücke". Vergleiche L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 141-142, mit "Abb. 15A-C Anfügung der Figur des älteren Sohnes (Teile C & G) an die restliche Gruppe: der Schlangenkörper als Verbindungselement (Digitales Modell)"; vergleiche S. 141: "Diese Verbindungen [zwischen den Blöcken A und C/G] mussten nun bei der Montage reaktiviert werden. Dies war aber um so schwieriger, als wesentliche Teile der Schlangen verloren waren und der ganze Schlangenknoten um den rechten Arm des [älteren] Sohnes, der in der Antike mit dessen Körper ein einziges Teilstück gebildet hatte [= Block C], abgebrochen war und nun seinerseits [= Block G] wieder fixiert werden musste (Abb. 16A-B)"; vergleiche S. 142, ihre "Abb. 16A-B Anstückung des abgebrochenen rechten Armes (Teil G) an die restliche Figur des älteren Sohnes (Teil C) (Digitales Modell)".
93 siehe oben, zu Anm. 91. Die hier zitierten Maße sind in die folgenden Abbildung der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe eingetragen: L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 306, "Abb. 19 Die obere Schlange bei der rechten Schulter des Laokoon: Messung des Durchmessers des Schlangenkörpers (Digitales Modell)". Siehe hier Dias 31; 33, links; 34, links. Vergleiche L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 324, Abb. 51a; S. MUTH 2017b, 336, Abb. 1, S. 340, Abb. 9, S. 355, Abb. 2B, Taf. 20; S. MUTH, D. MARIASCHK, H. VOGLER 2017, 475, Abb. 11C.
94 die hier zitierten Maße sind in die folgenden Abbildung der Berliner Rekonstruktion der Laokoongruppe eingetragen: L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 306, "Abb. 20 Die untere Schlange: Messung des Durchmessers des Schlangenkörpers (Digitales Modell)".
95 vergleiche P. LIVERANI 2006. Das Zitat stammt von S. 37.
Vergleiche S. 126-127, Kat. "12 Giovanni Antonio da Brescia (Brescia 1490 ca.-Roma, ca. 1525) Laocoonte e i suoi figli 1506 ca. ... Incisione su rame ... Londra, British Museum, inv. 1845-8-25-707" (T. Bartsch); S. 152-153, Kat. "42 Marco Dente da Ravenna (Ravenna ante 1500-Roma 1527) Laocoonte 1520-1523 ca. ... Carta, incisione su rame ... Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, BAV, Stampe VI.3, n. 87" (T. S. = Timo Schtrauch?); S. 154-155, Kat. "45 Marco Dente da Ravenna (Ravenna ante 1500-Roma 1527) La morte di Laocoonte e dei suoi figli 1517-1520 ca. ... Carta, incisione su rame ... Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, BAV, Stampe V.6, n. 49" (T. S. = Timo Schtrauch?).
Auch F. MAGI 1960 hatte jene frühen Zeichnungen und Stiche, die zu seiner Zeit bereits bekannt waren, diskutiert, welche die Laokoongruppe kurz nach ihrer Auffindung darstellen, und hatte diese, zusammen mit allen übrigen diesbezüglichen Zeugnissen, bei seinen Überlegungen zur Restaurierung der Gruppe berücksichtigt. Bei ihm ist der Stich von Giovanni Antonio da Brescia Abb. 13 auf S. 18 (vergleiche S. 11, 17, 23). Auf S. 11 führt Magi den Nachweis, dass dieser Stich Quellenwert hat, anhand von Details an den rechten Armen des jüngeren und älteren Sohnes, welche, heute am Original verloren, auf dem Bronzeabguss von Francesco Primaticcio (1543, vergleiche hier Dias 23; 24) jedoch noch erhalten sind, und die gleichfalls auf diesem Stich erscheinen; S. 17 mit Anm. 13 (zum Stich von Giovanni Antonio da Brescia, der damals als älteste bekannte Darstellung der Laokoongruppe galt): "che è forse la più vecchia e fedele [riproduzione del gruppo]"; vergleiche S. 28 mit Anm. 15: MAGI hatte von diesen Details der Arme der beiden Söhne an Primaticcios Bronzeabguss Abgüsse in Paris angefordert, die er dann in seine Restaurierung der Gruppe integrieren konnte. Während heute der Bronzeabguss Primaticcios als unzweifelhafte dokumentarische Quelle angesehen wird, hatte MAGI (S. 11) noch `umgekehrt´ argumentiert: Er hielt diese Details an Primaticcios Bronzeabguss für verläßlich, weil sie auch auf den Stichen von Giovanni Antonio da Brescia und Marco Dente erscheinen (!): "Che questi due complementi conservati nel bronzo di Parigi [= Primaticcios Bronzeabguss] siano attendibili, lo attestano le più antiche riproduzioni del gruppo nelle quali, invero, del figlio maggiore è rappresentata col polso anche la mano destra più o meno integra (tavv. XI, XII e XIV, I, e fig. 13)"; seine Tav XI, I zeigt den Stich von Marco Dente; Tav. XI, 2 zeigt den Stich von Beatriccetto; seine Tav. XII: "Vaticano, Appartamento delle Guardie Nobili: affresco con veduta dell'Esquilino e il gruppo del Laocoonte" (sie dazu S. 17f.); seine Tav. XIV, I: "Firenze, Museo Nazionale: due piccoli bronzi cinquecenteschi riproducenti il Laocoonte senza e con restauri"; seine Fig. 13 zeigt, wie gesagt, den Stich von Giovanni Antonio da Brescia.
L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 137-138 sprechen dagegen dem Stich des Giovanni Antonio da Brescia (bei ihnen Abb. 9), sowie den Graphiken von Marcantonio Raimondi (bei ihnen Abb. 10), und von Marco Dente (bei ihnen Abb. 11 = in F. BURANELLI et al. 2006, Kat. 42), Dokumentationscharakter ab; vergleiche S. 138: "Nicht die Dokumentation eines konkreten Zustands ist das Interesse dieses Stichs [von Marco Dente], sondern die Vermittlung einer Vorstellung - die eines in antiken Ruinen gefundenen und nun allseits berühmten Meisterwerkes ... Entsprechend kann der Stich Dentes kaum als getreue Illustration der Statue im Moment ihrer Auffindung interpretiert werden".
96 vergleiche für die anonyme Federzeichnung in Düsseldorf, F. BURANELLI et al 2006, 125-126, Kat. "11 Anonimo artista bolognese Laocoonte e i suoi figli post 14 gennaio 1506 -ante 1508 ... Bistro marrone passato a penna, sfumature a pennello, sfondo dipinto successivamente in blu ... Düsseldorf, Kunstmuseum, Graphische Sammlung, inv. FP 7032" (T. Bartsch).
Diese Federzeichnung hat MAGI 1960 noch nicht berücksichtigen können, weil sie erst von Matthias Winner entdeckt, und 1974 publiziert worden ist; vergleiche M. WINNER 1974, 99-102, Abb. 14; 14a.
Vergleiche für die anonyme Federzeichnung im Kunstmuseum Düsseldorf auch S. MUTH, R.F. SPORLEDER 2017, 47. Hier wird behauptet, dass der Kopf der `oberen´ Schlange, der auf der Zeichnung sichtbar ist, ergänzt sei: ["Datum":] "vor 1. Juni 1506", ["Ereignis":] "Überführung in die päpstliche Villa des Belvedere", ["Reparaturen, Ergänzungen, Rekonstruktionen":] "Erste Restaurierungen am Sockel, erste Ergänzungen (z.B. Kopf der oberen Schlange) ... [daneben ist diese Zeichnung abgebildet]". Vergleiche S. MUTH 2017b, 101, mit Anm. 16, Abb. 23 und Verweis auf Essay 6 (hier im Folgenden zitiert).
Vergleiche L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 136, "Abb. 8 Anonyme Federzeichnung der Laokoongruppe (ca. 1506-08), Düsseldorf"; vergleiche S. 136: "Gemeinhin wird eine anonyme Federzeichnung in Düsseldorf als frühestes Zeugnis des wiedergefundenen Laokoon angesprochen [mit Anm. 26, mit Hinweis auf den Essay 13 von S. SCHÄFER-ARNOLD im selben Band, und Angabe von Literatur] (Abb. 8) ...". Auf S. 136-137 bringen die Autoren zum Ausdruck, dass es sich bei dieser Zeichnung ihrer Meinung nach keineswegs um die Dokumentation eines zu diesem Zeitpunkt möglichen Zustandes der Gruppe handeln könne, sowie, dass ihrer Ansicht nach der Kopf der `oberen´ Schlange auf dieser Zeichnung: "frei hinzugefügt" sei.
Vergleiche S. 137: "Die Zeichnung lässt von dem prekären, fragilen Zustand der Fragmente kaum etwas ahnen. Sie suggeriert eine Mühelosigkeit der Wiederherstellung, die indessen nur auf dem Papier besteht. Man braucht sich nur die konkreten Bruchstücke (und deren Gewicht!) zu vergegenwärtigen, um den imaginären Charakter der Darstellung zu begreifen. Sie ist keineswegs die Widerspiegelung eines gegebenen Zustands der Gruppe. Viel eher handelt es sich um eine Entwurfszeichnung: Der Autor versuchte - zu einem Zeitpunkt, als die Fragmente der Gruppe noch unverbunden waren - eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie das Ganze nach der Zusammensetzung vielleicht aussehen würde. In diesem Sinne - als Konstruktion, und nicht als Dokumentation - dürfte auch der nicht erhaltene, sondern frei hinzugefügte Kopf der Schlange zu verstehen sein, der Laokoon in die Hüfte beißt (siehe dazu unten)": Mit ihrem letzen Zusatz beziehen sich die Autoren auf S. 144-147: "2.1. Ein erster Schritt: der Kopf der Schlange".
Vergleiche zu der anonymen Federzeichnung in Düsseldorf ferner, L. GIULIANI, S. MUTH 2017, 147, Abb. 22A; S. SCHÄFER-ARNOLD 2017, 220, "Abb. 1 Bologneser Künstler, Laokoon, 1506, Düsseldorf, Museum Kunstpalast, Graphische Sammlung, Sammlung der Kunstakademie, Inv.-Nr. KA (FP) 7032"; vergleiche S. 219 (zu Abb. 1): "... Die Zeichnung dokumentiert zwar den Erhaltungszustand der antiken Skulptur [mit Anm. 6, mit Lit.], nicht jedoch die Auffindungssituation [mit Verweis auf Essay 6 im selben Band von L. GIULIANI, S. MUTH, siehe die oben zitierten Passagen ihres Textes]. Die Figur des älteren Sohnes wurde bereits durch Stützen mit dem Vater zu einer Gruppe zusammengesetzt und der in die Hüfte beißende Schlangenkopf dargestellt, der nach neueren Untersuchungen nicht Bestandteil der antiken Gruppe ist", mit Anm 7 (mit Literatur), und Verweis auf Essay 6 und Essay 20 im selben Band, beide von L. GIULIANI, S. MUTH. Für die im Folgenden zitierten Passagen aus dem Essay 20 von L. GIULIANI, S. MUTH 2017, siehe unten, Anm. 100, 103.
97 zu MAGI 1960, 11, siehe oben, Anm. 95. Zu den diesbezüglichen Äußerungen von L. GIULIANI und S. MUTH sowie S. SCHÄFER-ARNOLD, siehe oben, Anm. 96.
98 vergleiche P. LIVERANI 2006, 38 mit Anm. 56, 60, 61 (mit Angabe von Literatur); vergleiche hier Anm. 79, 92, 108.
Datenschutzerklärung | Impressum